Heimatkundliche Berichte von Reinhard Schütte
Im folgenden werden hier heimatkundliche Berichte von Reinhard Schütte aufgeführt.
Die Schule nach dem Krieg (1945 bis 1971)
|
Zwei Ascheberger Männer, der Bauer Josef Wintrup und sein Nachbar der aus Aachen stammende Lehrer Dr.Eduard Pistorius, gingen den einrückenden Amerikanern in der Nacht zum Karfreitag 1945 mit einer weißen Fahne entgegen und versicherten ihnen, daß keine deutschen Truppenteile in Ascheberg Widerstand leisten würden. In der Schule an der Albert-Koch-Straße hatte sich in den letzten Märztagen 1945 eine Divisions-Marketenderei niedergelassen, die noch am Gründonnerstag von zurückflutenden deutschen Soldaten leergekauft wurde. Nach dem Einzug der Amerikaner stürmten die befreiten Kriegsgefangenen – Polen, Russen, Italiener, Belgier, Holländer – in die Schule und richteten sich dort häuslich ein. Die Schulmöbel wurden zur Seite geschafft, zum Teil zerstört oder als Brennholz verwandt. Lehrer Schomberg versuchte, die Schulakten in Sicherheit zu bringen. Noch brauchbare Schulbänke wurden gerettet und und bei Bauern untergebracht. Immer mehr Ausländer kamen, die Unterbringung wurde immer schwieriger, und die Reibereien nahmen zu. Außer der Schule wurden auch die ehemaligen Flakbaracken auf Schulze Frenkings Kamp, die Schule Himmelstraße, das Vereinshaus (heute Pfarrheim) die Häuser von Forsthoff, Klaverkamp, Dr. Koch, Bücker/Dorfheide, und andere mit Beschlag belegt. Die Ascheberger mußten alle verpflegen. Fremde Mädchen boten „unsittliche Geschäfte“ an. Das Wild in den Bauerschaften wurde erlegt und an der Südseite der neuen Schule zubereitet. Aber im Juli und August 45 rückten schließlich alle Fremden allmählich ab, und Ascheberg atmete auf. Am 10. September 1945 konnten die Schulen wieder mit dem Unterricht beginnen. An Lehrpersonen waren verfügbar: Herr Neukämper, Rektor Jansen, Frau Merten, Frau Heukamp, Frau Störkmann, Frau Wirtz, Frau Beckmann, Frau Höhne und anfänglich Dr. phil Pistorius.Alles nazistische Gedankengut sollte so schnell wie möglich ausgerottet werden. Das Fach Geschichte durfte nicht unterrichtet werden. Auch die Lesetexte für den Deutschunterricht durften nur solchen Werken entnommen werden, die keine geschichtlichen und politischen Themen behandelten. Bibel und Katechismus waren unverfänglich und dienten als Lesestoff. Alle irgendwie naziverdächtigen Lehr- und Lernmittel waren zu vernichten oder der Fa. Lademann in Langenberg/Rhdl zum Einstampfen zu übergeben. Das alles wurde „streng durchgeführt“. Die Militärregierung mußte jedes Unterrichtswerk genehmigen. |
|
Das Schuljahr 1946 brachte etwas Neues: 55 evangelische Kinder aus vorwiegend heimatvertriebenen Familien neben 459 katholischen aus einheimischen Familien besuchten die nun wieder katholische Volksschule. Aber am 20.August 1947 wurde eine evangelische Schule für 100 Kinder in dem Gebäude an der Himmelstraße eingerichtet. In beiden Schulen durfte auch 1947 noch immer kein Geschichtsunterricht erteilt werden. 1948 kam die Währungsreform. „Um der besonderen Not der Flüchtlingslehrer zu steuern, wurde von jeder Lehrperson monatlich 1,00 DM gespendet.. Am 1. Oktober 1948 wurde für 66 Kinder die Schulspeisung eingeführt. Die Speisen wurden von der amerikanischen Heeresverwaltung mit Unterstützung des Landes NRW abgegeben. Die Kinder zahlten 60 Pg. pro Woche. „Kinder von Selbstversorgern und Teilselbstversorgern konnten nicht beteiligt werden. Frau Hülsmann bereitete im Schulkeller die Speisen, und bei Frau Rump (heute Familie Elbers, Albert-Koch-Straße) wurden die Vorräte gelagert. |
 |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Albert-Koch-Straße
|
Nach dem Sanitätsrat Dr. med. Albert Koch, Arzt in Ascheberg, hier geboren am 24. 4.1858 und auch hier gestorben am 12.4.1941, ist diese Straße benannt worden. Pfarrer Fechtrup meinte, Dr. Koch hätte den Kopf geschüttelt und gelacht, wenn er erfahren hätte, daß man eine Straße nach ihm benennen würde. Er wohnte und praktizierte in seinem Elternhaus auf der Sandstraße am Friedhof, das heute der Familie Walz gehört.Eine Nachbarin erinnert sich, daß sie als Kind von Dr. Koch behandelt worden ist. Er habe sehr weiche Hände gehabt und sei sehr freundlich gewesen, besonders zu Kindern. Für ein Honorar von 1 Mark sei er mit dem Fahrrad bis in die Bauerschaften gefahren. Er hat gewiß auch Patienten auf der Albert-Koch-Straße, die zu seiner Zeit noch Lohstraße hieß, behandelt, aber nicht viele, denn dort standen vor dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Häuser: an der rechten Seite, von der Kirche her gesehen, das Haus Wiggermann ( heute Brochtrup) und das Doppelhaus für die Lehrer am Schulplatz, das Haus Franz Högemann und das Haus Nientidt; an der linken Seite die Häuser Evers (noch in der Kurve), die kleinen Mietwohnungen von Linnemann,dann die Häuser Lüningmeyer (heute Stattmann), Rüller, Rump (heute Elbers) und Klaverkamp. Die Albert-Koch-Straße beginnt am Kriegerdenkmal, das der aus Ascheberg stammende münstersche Bildhauer Anton Rüller 1927 erbaut hat. Es war das zweite Denkmal an dieser Stelle. Das erste wurde 1913 aus großen aufeinandergetürmten Findlingen errichtet. Anlaß war die Hundertjahrfeier der Völkerschlacht bei Leipzig und der Stiftung des Eisernen Kreuzes und das silberne Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II. Einige der Findlinge liegen dort heute noch. Die Albert-Koch-Straße war eigentlich die Fortsetzung der Lohstraße, die von der Dieningstraße abzweigte und ins Loh,einen Teil des Alten Feldes, führte. Deshalb nannte man die 1936 eröffnete Volksschule „die Schule an der Lohstraße“ ((Es gab ja schon drei Schulen im Dorf: an der nördlichen Sandstraße (heute Haus Josef Raters), an der Himmelstraße (heute Parkplatz an der Volksbank) und auf dem Platz der früheren Sparkasse an der Ecke Dieningstraße/Kirchplatz.)). Zwischen der Schule und dem Löwendenkmal stehen heute ein vor wenigen Jahren erbautes Haus mit 6 Eigentumswohnungen und das 1958 erbaute Haus der Familie Aloys Brochtrup sen. Vorher stand hier das kleine Fachwerkhaus der Familie Wiggermann, das durch Heirat an die Familie Brochtrup kam. 1935/36 wurde in der „Holtwieschk“, einer nassen, tiefliegenden Wiese, die neue Volksschule gebaut. Sie wurde von 1936 bis 1957 als „neue Schule“ bezeichnet. 1957 bekam sie den Namen St.-Michael-Schule. In diesem Jahr erhielt sie auch den südlichen zweigeschossigen Anbau. 1960 stellte man in der Schule eine große Holzstatue des Erzengels Michael auf, die der Bildhauer Heinrich Gerhard Bücker in Vellern geschaffen hatte. 1994/95 wurde die eingeschossige Schule von 1936 nach den Plänen des Architekten Axel Simon um eine Etage aufgestockt. 1936 errichtete die Gemeinde neben der Schule ein Doppelhaus mit zwei Lehrerdienstwohnungen. Die ersten Mieter waren die Lehrer Theo Neukämper in der östlichen Wohnung und Heinrich Schomberg in der westlichen. 1976 verkaufte die Gemeinde die beiden Haushälften an die bisherigen Mieter Hermann Windmüller und Monika und Reinhard Schütte. Die Windmüllersche Hälfte erwarben 1996 Ida und Franz Oel-schläger, der Hausmeister an der Grundschule ist. Das benachbarte Haus von Franz Högemann, Maler- und Anstreicherbetrieb, ist 1936 erbaut worden. Es gehört mit den Häusern Nientidt (daneben) und Klaverkamp (gegenüber) zu den neueren Hausstellen, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Alle weiteren Häuser entstanden erst nach 1948. Graf von Galen verkaufte seine Ländereien als Bauplätze. Die Bauwilligen verhandelten in der damals auf Haus Bisping in Rinkerode untergebrachten Galenschen Rentei mit dem Rentmeister Kaufmann. Erste Bauherren waren Max Walz und .....Nehmen (?), dessen Haus später Hermann Mersmann kaufte. Es folgte Helmut Kleykamp auf der rechten Seite der Straße, die damals noch als Lohstraße bezeichnet wurde. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Gemeindewappen
|
Im Glauben an Tibus und Schwieters ließ sich die Gemeinde Ascheberg 1962 ein von dem Grafiker Waldemar Mallek entworfenes redendes Wappen genehmigen, das eine stilisierte grüne Esche auf goldenem Grund über roten Zinnen mit drei goldenen Kugeln zeigt. Die Esche und die Zinnen sollen die „Eschenburg“ symbolisieren und die drei goldenen Kugeln die Burg in Davensberg, denn sie stammen aus dem Siegel des Hermann von Meinhövel, des ersten Herrn dieser Burg. Das Wappen von 1962 (links) ist hier nicht in Farbe, sondern in den heraldischen Schraffuren abgebildet, die das Gold durch schwarze Punkte, das Grün durch schräg nach links gerichtete Linien und das Rot durch senkrechte Linien wiedergibt. Das rechte Wappen zeigt einen Baum mit waagerechten Schraffuren, die Blau ersetzen. Es ist das Gemeindewappen nach der Vereinigung mit Herbern, mit dessen Wappenfarbe Blau die Ascheberger Esche umgefärbt wurde. Ein sparsames Verfahren, dem die Herberner erstaunlicherweise zugestimmt haben, obwohl es sicher noch andere Lösungen gegeben hätte, die die Stellung Herberns in der neuen Gemeinde deutlicher betont hätten. Im täglichen Dienstgebrauch werden weder Farben noch Schraffuren verwendet, so daß der Herberner Anteil meistens nicht zu sehen ist. 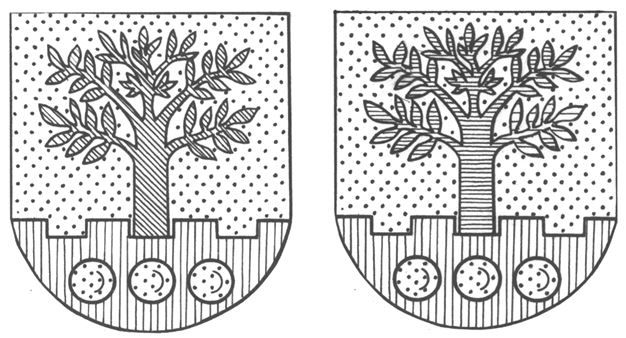 |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Gedanken zu den Kabinettscheiben im Ascheberger Pfarrhaus
|
Sie sind 1845 für den Neubau des Ascheberger Pfarrhauses von uns unbekannten Spendern gestiftet worden. Die sechs Scheiben sind etwa 50 cm breit und 60 cm hoch und alle nach der gleichen Art, vielleicht nach gleichem Muster gearbeitet. Fünf von ihnen zeigen Symbole, die zusammen mit lateinischen Bibelzitaten zu Frömmigkeit und Gottesliebe auffordern. Auf der 6. Scheibe sieht man dagegen eine kleine Dorfkirche mit einem Fachwerkhaus und zwei großen Tannenbäumen daneben. Die Gruppe steht hinter einem mittelalterlich anmutenden Flechtzaun. Der lateinische Text stammt nicht aus Ps.113,9 wie irrtümlich angegeben, sondern aus Ps.115,9 : Domus Israel speravit in Domino, adjutor eorum et protector eorum est. (Das Haus Israel hoffte auf den Herrn, er ist ihr Helfer und Beschützer) Kirche und Haus könnten auch hier Symbole für das zitierte "Haus Israel", also für die auf Gott vertrauende Gemeinschaft der Gläubigen, sein, wenn nicht darunter das Wort fiehttharpa stände. Es scheint eine Erklärung, ein Hinweis auf die Kirche darüber zu sein. Das Wort ist kleingeschrieben und die Buchstaben in gotischer Schrift unterscheiden sich auffallend von der Kursivschrift des Psalmenzitats. Das unverständliche und von keinem bekannten Wort unserer Sprache abgeleitete fiehttharpa gibt Rätsel auf, und bislang ist seine Bedeutung nicht geklärt worden. Der Verdacht, es könne eine sehr alte Ortsbezeichnung, etwa aus dem Althoch- oder Niederdeutschen, sein, wird durch einen Blick in das Freckenhorster Hebere-gister aus der Zeit um 1100 n. Chr. bestätigt: fiehttharpa ist der älteste Name für Füchtorf. Demnach ist der dargestellte Ort das Dorf Füchtorf. Und tatsächlich ist die Kirche die 1840 wegen Baufälligkeit abgebrochene alte Kirche Mariae Himmelfahrt in Füchtorf, von der es allerdings keine Abbildung gibt, nur eine Skizze des mit der Planung eines Neubaus befaßten Bau-Inspectors August Ritter aus Münster. Diese Skizze zeigt deutlich eine Kirche, die der auf der Ascheberger Kabinettscheibe entspricht. Die geringfügigen Unterschiede, etwa bei der Höhe des Kirchendaches, sind verständlich, denn die Kabinettscheibe wurde 1845, ca. 5 Jahre nach dem Abbruch der Füchtorfer Kirche, hergestellt. Der Künstler konnte also keinen Vergleich mit dem Original mehr anstellen. Es bleibt also die Frage: Was veranlasste den Spender der Scheibe, dem Ascheberger Pfarrer eine Darstellung der alten Füchtorfer Kirche zu schenken? War er mit dem Pfarrer befreundet oder ein Verwandter? Der Ascheberger Pfarrer Anton Üing war 1802 in Seppenrade geboren, sein Füchtorfer Amtsbruder Johann Heinrich Föcking 1803 in Südlohn. Sie könnten durchaus Freunde oder Verwandte gewesen sein. Im gleichen Weihekurs waren sie nicht, denn Föcking wurde 1831, Üing aber schon 1828 zum Priester geweiht. Da aber alle fünf Kabinettscheiben von gleicher Gestaltung sind, werden sie auch aus der gleichen Werkstatt und vom gleichen Spender stammen. Wer aber schenkte damals sechs solcher Scheiben auf einmal? Oder warum ließen sechs verschiedene Spender ihre Scheiben in der gleichen Werkstatt herstellen? Es ist überhaupt überraschend, dass um die Mitte des 19.Jh. noch Geschenkscheiben dieser Art in Auftrag gegeben wurden. Ihre große Zeit, die schon im frühen Mittelalter begonnen hatte, war eigentlich vorbei. Um 1840 konnte man schon große Scheiben aus hellem Glas herstellen. Die Kabinettscheiben in Ascheberg könnten damals schon als etwas altertümlich angesehen worden sein. Vielleicht sollten sie das auch, denn das Wort fiehttarpa auf der Füchtorf-Scheibe ist in gotischen Buchstaben geschrieben und das möglicherweise mit Absicht. Um 1840 war die romantische Rückbesinnung auf das frühe Mittelalter weit verbreitet, und daher könnte dieser Schriftzug zusammen mit dem Bild der sehr alten romanischen Kirche (die schon abgebrochen war) so etwas wie ein Bekenntnis zu den christlichen Werten jener frühen Zeit gewesen sein. Das Freckenhorster Heberegister aus der Zeit um 1100 n.Ch. ist 1840 zum ersten Mal veröffentlicht worden. Bis dahin war das Original nur wenigen Fachleuten bekannt. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Stifter, der zweifellos den gebildeten Schichten angehörte, aus Freude über die Ersterwähnung Füchtorfs in diesem ehrwürdigen Dokument dem Ascheberger Pfarrer diese Scheibe zur Ausstattung der Fenster seines neuen Hauses schenkte. Die anderen fünf Scheiben zitieren bekannte Stellen aus dem Alten und Neuen Testament und zeigen dazu ein entsprechendes Symbol: "Tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam (Flöten und Harfen verschönern das Lied) " Jesus Sirach, 40,21, dazu eine Flöte und eine Harfe - "Posuit me sicut sagittam electam: in pharetra sua abscondit me (Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher)" Jesaia 49,2, dazu ein Köcher mit Pfeil und Bogen - "Implemini Spiritu Sancto loquentes vobismetipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus (Laßt in eurer Mitte Psalmen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt)" Epheser 5,19, dazu eine kleine Orgel - "Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus (Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig)" Math. 10,38, dazu ein Holzkreuz mit einer Dornenkrone -, "Nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? "(Hat nicht Gott die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?1.Kor.1,20), dazu ein Buch mit der Inschrift "DE DEO UNO ET TRINO" (Über den dreieinigen Gott)" auf dem Buchdeckel. Die Bilder sind alle gleich groß, die Symbole weiß ausgemalt, mit Schwarzlot auf einen Gelbsilbergrund gezeichnet und von einer im späten Rokokostil gehaltenen Dekoration umrandet. Heute hängen die Scheiben in neuen Metallfassungen als Kabinettscheiben vor drei modernen Fenstern. Es handelt sich um sog. Fensterbierscheiben, d.h. um künstlerisch gestaltete Fensterscheiben, die man früher einem befreundeten Bauherrn schenkte, wenn dieser daran ging, seine Fenster einzubauen. Diese Schenkung war natürlich abgesprochen, und der Bauherr konnte mit der Lieferung der Scheiben sicher rechnen. Wenn dann das Haus fertig war, lud er die Stifter ein und bewirtete sie. Anscheinend spielte das Bier dabei eine so bedeutende Rolle, dass diese Geselligkeit Fensterbierfeier oder kurz Fensterbier genannt wurde. Auch die Ascheberger Scheiben dürften 1845 solche Geschenke an den damaligen Pfarrer Üing für sein neues Pfarrhaus gewesen sein. Das ist nicht eindeutig nachgewiesen, aber kaum anders zu erklären. |
|
Kartusche: Dorfkirche mit Häusern und Tannen, unterschrieben: fiehttharpa / = Füchtorf) Text: Domus Israel speravit in Domino, adjutor eorum et protector eorum est. Ps 115,9 ( Das Haus Israel hoffte auf den Herrn. Er ist sein Helfer und Beschützer) |
 |
 |
Kartusche: Bogen und Köcher mit Pfeilen - Text: Posuit me sicut sagittam electam: in pharetra sua abscondit me. Jes. 49,2 (Er machte mich zu einem spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher) |
|
Kartusche: Kreuz mit Dornenkrone. Text: Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. Matth.10,38 (Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.) |
 |
 |
Kartusche: Buch mit Aufschrift DE DEO UNO ET TRINO . Text: Nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? (Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Torheit entlarvt?) |
|
Kartusche: Orgel mit gerolltem Notenblatt dahinter. Text: Implemini Spiritu Sancto loquentes vobis metipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus. Eph. 15,9 ( Laßt in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt) |
 |
 |
Kartusche: Lyra und Flöte. Text: Tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam . Sr. 40.21 (Flöten und Harfen verschönern das Lied) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Kirchturm und der Pfarrgarten in Ascheberg vor 1908
|
Im Jahre 1472 erhielten Maurermeister Lambert Schweppel und sein Sohn Matthäus den Auftrag, den damaligen, wahrscheinlich ziemlich kleinen Kirchturm um etwa 12 Meter zu erhöhen. Dieser Turm blieb bis 1908, dann musste er dem heutigen weichen. 1783 schlug der Blitz in die Turmspitze und zerstörte auch einen Teil des Schweppelschen Mauerwerks. Der Turm bekam nun eine barocke Haube, die die Leute bald zu spöttischen Bemerkungen reizte (Streudose für Salz und Pfeffer o.ä.). Als Schweppel-Vater und -Sohn den Turm vergrößerten, stand noch die uns unbekannte, vermutlich recht kleine Kirche dahinter. Aber einige Jahrzehnte später entschloss man sich, die heutige große Hallenkirche an den Turm zu bauen. 1524 müsste sie eingeweiht worden sein, denn diese Zahl steht neben der Sakristei über einer zugemauerten Tür. Der Turm war damals noch "neu", und so ließ man ihn, wie er war. Wie das aussah, zeigt die nach einem alten Foto angefertigte Zeichnung. Einen zum Neubau passenden Chor konnte man sich damals nicht leisten. Das Kirchenschiff wurde an der Ostseite durch eine gerade Wand geschlossen, und den Altar stellte man in die Mitte davor. Erst 1737/40 ließ die Gräfin Plettenberg-Nordkirchen den Chor durch Johann Conrad Schlaun anbauen. |
|
Das Pfarrhaus wurde von außen erst 1845 in die heutige Form gebracht, von innen erst 1970. Der große Pfarrgarten ist heute noch erhalten. Auf der Zeichnung sieht man zwei benachbarte Häuser neben dem Pastorat. Sie wurden beide um 1920 abgebrochen, als man an ihrer Stelle das Vereinshaus (Pfarrheim) baute. In dem linken Haus wohnte der Vikar, das andere war ein kleines Geschäftshaus. Beide Häuser waren natürlich Fachwerkbauten, das Pfarrhaus aber seit 1845 nicht mehr. Die Kaplanei stand - hier nicht sichtbar - auf der anderen Seite. Das Haus des Pfarrers war um einige Meter vom Kirchplatz zurückversetzt, die Häuser der Hilfspriester nicht. Wie die Seitenflügel eines Schlosses sekundierten sie rechts und links dem Haupthaus des Pfarrherrn. Wahrscheinlich hatte die Vikarie ihren Eingang zum Pfarrhaus hin, bei der Kaplanei war es sicher so. So konnte der Pfarrer kontrollieren, wer bei den jungen Mitbrüdern ein- und ausging. Die Kaplanei, die privat vermietet war, wurde erst bei der Ortskernsanierung 1970/80 abgebrochen. Die Stufen der Seitentreppe führten früher nach Süden in den Garten, 1970 hat man sie an die andere Seite verlegt. |
 |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Ascheberger Pfarrhaus
|
Wann das erste Pfarrhaus in Ascheberg gebaut wurde, ist nicht bekannt. Um 1660 ließ der damalige Pfarrer Wennemar Uhrwercker sein weitgehend verwahrlostes Pfarrhaus durch ein neues ersetzen. 1662 war es fertig. Um 1840 war es zu klein und auch baulich in schlechtem Zustand, so dass ein Umbau nötig wurde. Pfarrer Anton Üing konnte 1845 in das heutige Haus einziehen. Es war kein richtiger Neubau, mehr ein Umbau, aber das alte Haus wurde wesentlich verändert und erheblich vergrößert. Damals setzte man auch die lateinische Inschrift über das Hauptportal: HVIC DOMVI AC HABITANTIBVS SALVS LAETA VIRTVS ET PAX (Diesem Hause und seinen Bewohnern sei frohes Heil, Kraft und Frieden). In dem lateinischen Text ist die Jahreszahl 1845 enthalten. Jedes V wird als U gelesen, hat aber den Zahlenwert 5. Demnach gilt: V+ I+ C+ D+ M+ V+I+ C+ I+ I+V+L+ V+L+V+I+V+ X = 5+1+100+500+1000+5+1+100+1+1+5+50+5+50+5+1+5+10 = 1845. |
 |
|
Einteilung des alten Pfarrhauses: Hinter der Eingangstür war rechts und links ein kleineres Zimmer. Ein Flur führte in die Küche, d.h. in einen großen Raum, der aber nicht mehr als Küche benutzt wurde. Die eigentliche Küche war rechts von diesem Raum abgetrennt und lag etwa dort, wo heute die Küche der hinteren Wohnung ist. Links von der alten Küche, also zur Gartenseite hin, lagen hintereinander zwei durch eine Tür miteinander verbundene größere Räume, die als Konferenzräume dienten. Hinter der Küche zur Südseite hin war das Arbeitszimmer des Pastors. Daneben hatte man in jüngerer Zeit eine kleine Toilette eingebaut. Von der alten Küche aus stieg man auf einer breiten, an beiden Seiten geschlossenen Treppe in das Obergeschoß, wo die Schlafräume lagen. Vom Obergeschoß führte die Treppe zum Dachboden, der sehr groß war und eine hölzerne Seilwinde für den Materialaufzug in der Dachgaube an der Westseite hatte. Der Dachboden hatte früher als Lagerraum, u.a. auch für Korn, gedient. Der Pfarrer betrieb früher Landwirtschaft. An der Südwestecke des Pastorats war die Pfarrscheune angebaut. An der Verfärbung des Mauerwerks an der Ecke zum Katharinenplatz kann man heute noch erkennen, wo sich die Gebäude einst berührten. Die Scheune wurde in den sechziger Jahren abgebrochen. Sie sollte nach den Vorstellungen des Gemeindedirektors Rothers als Heimatmuseum an der dicken Eiche an der Herberner Straße (neben dem Haus van Nahmen) wieder aufgebaut werden. Daraus ist nichts geworden. Wo das Balkenmaterial geblieben ist, weiß man nicht. In diesem Pfarrhaus haben seit 1845 die Pastore Anton Üing bis 1883, Karl Sommer (1885 - 1890), Heinrich Kicküm (1891 - 1899), Prälat Joseph Degener (1899 - 1932), Jodokus Fechtrup (1933 - 1954) und Heinrich Plugge (1954 - 1966) gewohnt. Pfr. Plugge starb 1966, sein Nachfolger Pfr. Horstmann hat das Haus in der alten Einteilung nicht mehr bewohnt. Es sollte umgebaut werde, und Pastor Horstmann bezog die Wohnung im ehemaligen Kaplanshaus, in der heute Frau Kremer wohnt. Nach dem Umbau wohnte Pfr. Horstmann bis 1984 in der hinteren Wohnung. In der vorderen Wohnung des Pastorats wohnten die Kapläne Werner Schwarte (1970 - 1974) und Gerd Fasselt (1974 - 1976), der Vertriebenenseelsorger Pfr. Winfried König (1976 - 1980) und der Polizeiseelsorger Pfr. Heinz Gellenbeck. (1980 - 1982). Ihm folgten der emeritierte Pastor von St. Marien in Hiltrup Bernhard Ensink (1982 - 1996) und der emeritierte Pastor von Lippramsdorf Heinrich Beisch (seit 1997). Die Kapläne vor Werner Schwarte bewohnten, etwa seit 1910, das weiße Doppelhaus südlich des heutigen Pfarrheims. Da immer nur ein Kaplan da war, wurde eine der beiden Wohnungen an andere Ascheberger vermietet. Unter Pastor Horstmann wurde das Pfarrhaus um 1970 innen völlig umgebaut und dabei in der Mitte senkrecht geteilt, so dass zwei Wohnungen entstanden. Die ehemalige Gartentür wurde zum Eingang der hinteren Wohnung. Da die Stufen bislang an der Südseite der Treppe lagen, war der direkte Zugang vom Kirchplatz her erschwert. Deshalb verlegte man die Stufen an die andere Seite. Pfarrer Horstmann bezog die hintere Wohnung. Damit wurde die ehemalige Gartentür zum Haupteingang. Die gesamte innere Aufteilung der Räume wurde in beiden Wohnungen geändert. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Ascheberger „Katholische Kirchenblatt“ von 1929
|
Auf einem Ascheberger Dachboden fand sich unlängst ein stark vergilbtes und angeschmutztes Exemplar einer Zeitung, die sich „Katholisches Kirchenblatt für Ascheberg und Davensberg“ nannte. Nur wenige unter den ältesten Mitbürgern werden sich an diese Wochenzeitung erinnern. Denn das gefundene Exemplar war die Nummer 27 des ersten Jahrgangs und erschien zum 30. Juni 1929, einem Sonntag. Das örtliche Kirchenblatt war damals also noch sehr jung, ziemlich genau ein halbes Jahr alt, seine erste Ausgabe war zum 5. Januar 1929 verteilt worden. Ob der damalige Pfarrer Josef Degener Herausgeber und wohl auch gleichzeitig Redakteur war und wo das Blatt gedruckt wurde, ist dem gefundenen Reststück nicht zu entnehmen. Unter dem Titelbild sind die Gottesdienstzeiten abgedruckt und wahrscheinlich auch das Evangelium dieses Sonntags.  Das Bild misst im Original etwa 10 mal 20 Zentimeter. Es zeigt die Ascheberger Kirche und die Davensberger Kapelle, beide von der Nordseite. Die Vikarie Davensberg war damals noch ein Teil der Ascheberger St.-Lambertus-Gemeinde. Sie befand sich jedoch auf gutem Wege, selbstständig zu werden. Die Gestaltung des Zeitungskopfes ist bemerkenswert. In der Mitte steht der Heilige Lambertus, an seiner rechten Seite die Ascheberger Kirche, an seinen linken die Davensberger Anna-Kapelle. Lambertus ist liturgisch als Bischof gekleidet und trägt Stab und Mitra. Die Schrift ist sehr gleichmäßig und scheint eine Druckschrift zu sein. Aber die beiden kleinen g in den Ortsnamen sind unterschiedlich geformt und könnten auch eine Künstlerschrift verraten. Im Vergleich mit der Ascheberger Kirche ist die Anna-Kapelle zu groß gezeichnet, wohl der harmonischen Gestaltung wegen. Aber auch das Ascheberger Kirchenschiff ist etwas länger als in Wirklichkeit. Vielleicht hatte Pfarrer Degener dem Zeichner erklärt, dass eine östliche Verlängerung der Kirche geplant sei und ihn gebeten, das schon zu berücksichtigen. Das Bild wird beherrscht von der Gestalt des Bischofs Lambertus, womit vermutlich betont werden soll, dass er der Patron der Gesamtpfarrgemeinde ist, St. Anna dagegen die Patronin der damals untergeordneten Davensberger Vikarie. Im Ascheberger Kirchturm hingen Glocken, die die Davensberger Familie Schulze Hobbeling für den 1910 eingeweihten Turm gestiftet hatte. Die Verstorbenen aus Davensberg wurden auf dem Ascheberger Friedhof beerdigt. Kirchlich lebten die Katholiken damals noch unter einem Dach, Pfarrer Degener war für beide Ortsteile „unser Pastor“. Lambertus schaut nicht besonders freundlich drein. Das sollte er auch nicht. Denn die Zeiten waren nicht danach. Die festgefügte Ordnung der Monarchie war zerstört, der Kaiser seit Jahren im Exil, die Folgen des Krieges überall spürbar, die junge Demokratie kämpfte um Anerkennung, radikale Gruppen drängten nach politischer Macht. Auf wen sollte man hören? Das war für Pfarrer Degener klar: Auf Männer und Frauen, die sich mit höchsten Maßstäben messen ließen, die großen Gestalten der abendländischen Geschichte, zu denen auch Lambertus gehört, Bischof von Maastricht und häufig Gast am fränkischen Königshof, ein Mahner und Warner in schweren Zeiten, ermordet um 705 in Lüttich. Joseph Degener hatte als junger Kaplan im Kulturkampf staatliche Willkür ertragen müssen. Er wünschte sich und seiner Gemeinde eine – wie man damals oft sagte – gottgewollte Ordnung und wusste, wer dazu etwas zu sagen hatte: Lambertus. Der Zeichner hat einen Holzschnitt geschaffen, in dem kantiges Schwarz-Weiß und scharfe Linien herrschen. Die starken Hände erinnern an Arbeiten von Friedrich Press. Vielleicht stammt die Zeichnung sogar von ihm. Die lateinische Umschrift „Sanctus Lambertus“ im Heiligenschein will darauf hinweisen, dass die lateinische Sprache durch die Jahrhunderte hindurch die Lehre der Kirche unverfälscht und unbeeinflußt von zeitbedingtem Denken bewahrt hatte. Auch daran hatte der Pfarrer gedacht. Das Lamberusbild sollte kein naheliegendes Schmuckmotiv, sondern eine Aufforderung zu einem Leben nach christlichen Grundsätzen sein. Daher der strenge, durchdringende Blick, der heute, nach mehr als 70 Jahren, doch reichlich pathetisch erscheint. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Burgwall
|
Zwischen dem Kirchplatz und der Herberner Strasse verläuft der Burgwall, eine kurze Strasse mit nur wenigen Häusern, von denen die meisten zwischen 1910 und 1930 entstanden sind. Er war um 1900 ein Feldweg, der am südöstlichen Kirchplatz begann, in die Lohstraße mündete und weiter ins Alte Feld führte, wo viele Dorfbewohner eine Weide hatten. |
 |
|
Mindestens seit 1885, vielleicht schon früher, erregte der Name Burgwall die Fantasie romantischer Heimatfreunde, die gelesen hatten, was der münstersche Historiker Adolph Tibus 1885 in seinem Buch „Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und Kapellen im Bereiche des alten Bistums Münster“ über Ascheberg geschrieben hatte, dass nämlich einige Teiche im Ortskern anzeigten, „wo früher der Rittersitz von Ascheberg gelegen hat“. Es gebe dort auch eine „bestimmte Gegend, welche der Burgwall heißt“. „Rittersitz von Ascheberg und Burgwall“ – das müssen damals faszinierende Begriffe gewesen sein, dazu noch aus der Feder eines angesehenen Historikers. Die Familiennamen Borgmann, Plässer und Schlüter wurden als Burgmann, Burgplatzanwohner und Burgtorschließer gedeutet, so dass kaum ein Ascheberger noch daran zweifelte, dass südlich der Kirche die Burg Ascheberg gestanden habe. Der letzte Rest eines Wassergrabens war bis zum Bau der Häuser Kühnhenrich und Dr. Schulze Thier vor einigen Jahren noch vorhanden. Er schien die Theorie von Tibus, der übrigens auch Julius Schwieters zustimmte, zu bestätigen. Diese Theorie kann bislang weder bewiesen noch widerlegt, sondern nur stark bezweifelt werden, und das sollte man unbedingt tun. Denn schon das u in Burgwall ist nicht gesichert. Für die Zeit um 1800 ist der Name Borgwall belegt. Das könnte zwar die plattdeutsche Form von Burgwall sein, aber als Borg bezeichnete man früher einen Flucht-, Vorrats- und Wehrspeicher, der in der Regel auf einem Gräften und wallumgebenen Platz stand. Er war oft als Wohnung mit einem Kamin eingerichtet und konnte Menschen, gelegentlich sogar Gäste, Vorräte und Wertgegenstände „bergen“. Deshalb nannte man ihn „Borg“. Eine solche Borg gab es früher zum Beispiel in Amelsbüren. Sie blieb beim großen Dorfbrand 1716 verschont und diente unter anderem als Lager für Kirchengeräte. Dass ein solcher Borgspeicher in Ascheberg südöstlich des Kirchhofes – etwa am heutigen Parkplatz vor dem Lambertus-Kindergarten gestanden haben kann, ist kaum zu bezweifeln, ebenso wenig, dass er durch einen aufgeschütteten Weg (Wall) mit dem Kirch- und Pfarrhof verbunden war. Und die Namen der Anwohner? Borgmann waren vielleicht Aufgaben an der Borg zugewiesen, Schlüter verwahrte den Borgschlüssel. Plässer aber hatte nichts mit der Borg zu tun. Er wohnte rund vierhundert Meter entfernt am „Plass“ an der Ecke Diening/Bultenstrasse im Haus Weber/Stenkamp. Die Borg ist abgebrochen. Der Weg zu ihr wurde später nach Osten hin verlängert und ausgebaut und weiterhin Borgwall genannt, bis man ihm, einem geheimen Wunsch folgend, den vornehmer klingenden Namen „Burgwall“ gab. Wann und auf wessen Initiative das geschah, ist unbekannt. Eine „Ritterburg“ gab es hier nie. Aber die bekannte Familie von Ascheberg muss doch eine Stammburg gehabt haben! Gewiss, aber vielleicht war das die Burg Ascheberg bei Burgsteinfurt, wo die Familie gerade zu der Zeit, das ist vor 1206, im Mannesstamm ausstirbt, als sie in den Ichterloher Urkunden auftaucht. Vielleicht ist der letzte Träger dieses Namens von Burgsteinfurt nach Ichterloh gezogen, weil er sich vom Bischof von Münster mit dieser Herrschaft belehnen ließ. Schwieters weiß, dass sie 1370 mit Ichterloh belehnt waren und vermutet, dass das „schon ein paar Jahrhunderte früher“ so war. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Schützenfeste des Kriegervereins
|
Schützenfeste sind sehr beliebt. In Ascheberg feiert man drei: das der Bürgerschützen, das der Bruderschaft St. Lambertus-Osterbauer und das gemeinsame von Kolping (gemeinsam von 1969 bis 2018) und St. Katharina-Berg und Tal aus den südlichen, etwas hügeligen Gegenden Hegemer und Lütkebauer. Wenig bekannt ist, dass auch der frühere Kriegerverein – seit 1959 „Kameradschaft ehemaliger Soldaten“ – ebenfalls beim jährlichen Kriegerfest einen Schützenkönig durch Wettschießen ermittelte, zum ersten Mal im Jahre 1871. „Die nationale Begeisterung nach dem siegreichen Feldzug gegen Frankreich 1870/71 ließ überall in Deutschland Vereine entstehen, in denen die soldatische Kameradschaft weiter gepflegt wurde.“ Mit diesen Worten beginnt 1972 ein Bericht zum 100jährigen Bestehen des Vereins und erklärt damit seinen Ursprung und Sinn. |
 |
|
Zwar wurde der Kriegerverein erst 1873 von der Königlichen Regierung zu Münster genehmigt, aber mit dem Vogelschießen begann man schon früher. 1871 heftete Theodor Heubrock seine Königsplakette als erste an die neue Königskette. Dieses Königsschießen ist aber im Protokollbuch nicht vermerkt. Auch das von 1872 nicht, bei dem B. Lüningmeyer König wurde und sich M. Frenster zur Königin nahm. Erst am 20. April 1873 schreibt der 1. Vorsitzende, der Arzt Dr. Theodor Wynen, das erste Protokoll des Vereins, übrigens mit einer grausamen Handschrift, die aber inzwischen in lesbare Druckschrift übertragen ist. Sein Vertreter ist H. Merten, dessen Namen der Doktor hartnäckig immer wieder mit ä schreibt, obwohl Merten ihn geduldig richtig daneben setzt. Dr. Wynen gehörte zu den Gründern des Ascheberger Krankenhauses. Er ist auch der Schützenkönig des Jahres 1873. Auf die Rückseite seiner Königsplakette setzt er die Verse: „Dem Kriegerbunde Glück und Heil. Auf Weh und Wunden gute Salbe. Auf groben Klotz ein grober Keil. Auf einen Schelmen – anderthalbe“. Im Jahre 1874 machen König Joseph Klaverkamp und Königin Catharina Klaverkamp es ihm nach: „Dem Kriegerbunde Heil und Glück! Ihn treffe nie ein Missgeschick. Wer stets getreu zur Fahne hält, auch mannhaft stirbt wie’s Gott gefällt. Bernard Klaverkamp in Vertretung Josefs“. 51 Königsplaketten hängen an der Schützenkette des Kriegervereins. Die letzten stifteten im Jahre 1936 Josef Wintrup und Toni Wintrup, geb. Schulze Frenking. Natürlich fehlt auch ein Hitlerbild mit der Umschrift „Dein Geist gab mir die Ehre wieder“ nicht. Dass das Gegenteil richtig war, wusste oder ahnten damals nur wenige. Die „Schatzgräbergeschichte“ dieser Königskette ist oft erzählt worden: Gegen Ende des Krieges vergräbt Anton Richter, der Schatzmeister des Vereins, die Kette auf seinem Acker hinter der dicken Eiche an der Herberner Straße, verrät die Stelle aber nicht einmal seiner Frau. Als er im Jahre 1946 stirbt, weiß niemand, wo die Kette liegt. Erst einige Jahre später können die Vereinskameraden sie mit Hilfe eines Minensuchgerätes finden und ausgraben. Heute liegt sie wieder im Archiv der Kameradschaft. Ein bei allen Schützenfesten zur Totenehrung beliebtes Lied ist das vom Guten Kameraden, das auch manchmal für die verstorbenen Kameraden von einem Trompeter am offenen Grab gespielt wird. Es ist das offizielle Trauerlied der Bundesrepublik, aber der Text von Ludwig Uhland wird nicht gesungen. Vielleicht aus gutem Grund, denn ein wirklich guter Kamerad scheint in dem Lied nur der Sterbende zu sein: „Einen bessern findest du nie.“ Den noch Lebenden zwingt der Kampf, dem schwer Verletzten die erbetene letzte Hilfe zu versagen: „(er) will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad. Kann dir die Hand nicht geben.“ Von einem letzten Liebesdienst hatte er auf dem Kasernenhof wohl nichts gehört. In den Jahren 1953 bis 1960 feierten einige ehemalige Rektoratsschüler ein kleines Schützenfest nach Väterart, natürlich mit einer Königskette und silbernen Königsplaketten daran. Die Kette wurde vor einiger Zeit aufgelöst und die Plaketten den inzwischen ergrauten Königen zurückgegeben. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Altenbegegnungsstätte
|
Die sog. „Altenbegegnungsstätte“ an der Südostecke des Lambertus-Kirchplatzes ist nun Eigentum der Gemeinde Ascheberg, ebenso die „Ruine Bultmann“ gegenüber. Während die Ruine allmählich immer abstoßender wirkt, sieht die Begegnungsstätte noch recht ordentlich aus und fände vielleicht Käufer, die sich mit so einem Häuschen anfreunden könnten. Künstler oder in verwandten Berufen tätige Leute mit einem kleinen Haushalt würden hier möglicherweise gern leben und durch das große Schaufenster interessierte Passanten ihre Arbeit und ihre Produkte sehen lassen. Natürlich spielt die Frage nach dem baulichen Zustand eine große Rolle. Aber in jedem Fall sollte die Überlegung, |
 |
|
wie man das in den Jahren 1550 – 1560 erbaute Fachwerkhaus erhalten kann, im Vordergrund der Planungen stehen. Neben dem großen Fenster befinden sich auf dem rechten Ständer Reste der Jahreszahl 1550 (oder folgender bis 1559), da die Einerstelle fehlt. Das Haus ist also eines unserer ältesten. Alt-Ascheberg-Dorf besitzt nur noch sehr wenige Fachwerkhäuser, die allmählich zu Seltenheiten geworden sind und nicht zerstört werden dürfen, auch wenn „neues Fachwerk“ geplant wird. Es muss daran erinnert werden, dass man um 1980 überlegte, ob das heutige Pfarrheim wegen seines schlechten Zustandes abgebrochen werden sollte. Außerdem meinte man, weißes Fachwerk gehöre ins Sauerland, aber nicht nach Ascheberg, wo immer nur Backsteinfachwerk gebaut worden sei. Kaum ein Ascheberger hatte bemerkt, dass das 1924 eingeweihte, damals Vereinshaus genannte Haus bewusst die Formen der vier an dieser Stelle abgebrochenen Häuser nachahmte und damit wenigstens die Erinnerung an diese zum Teil 1903 abgebrannten Gebäude wach hielt. Ursprünglich wurden auch in Ascheberg Fachwerke mit lehmverputztem Flechtwerk ausgeführt, das von Natur aus grauweiß aussah. Backsteinfachwerk konnten sich „kleine Leute“ kaum leisten. Heute ist man froh, dass das Vereinshaus gerettet werden konnte, auch wenn Backsteinfachwerk mehr dem heutigen Geschmack entspricht. Vielleicht werden wir uns eines Tages auch über eine restaurierte „Begegnungsstätte“ freuen. Dann könnten wir ihren reichlich pomadigen Namen getrost vergessen. Und was die „Ruine“ gegenüber angeht: Trotz des Wissens um die ehemaligen jüdischen Besitzer, die ja nicht von den Nazis vertrieben wurden, ist das unglückliche Gebäude kaum noch zu retten. Nur die recht originellen Schaufenster sollten in einen Neubau irgendwie wieder eingebaut werden. Alles Übrige halte ich für nicht erhaltenswert. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Bauernküche
|
Der Kochbereich besteht hier aus einem weiß emaillierten Küchenherd, den man auch als „Maschine“ (Kochmaschine) bezeichnete, denn er wirkte auf die ersten Benutzerinnen tatsächlich wie eine Maschine, die das Heizen, Kochen, Braten, Backen und die Erhaltung der Glut gegenüber dem offenen Feuer wesentlich erleichterte. Über dem Herd befindet sich der Rauchfang (Bosen), der auf zwei Kragsteinen ruht, von denen einer hinten sichtbar ist. Wo früher der Rauch des Feuers abzog, sind heute eine Lampe angebracht und eine Klappe zum Reinigen des Kamins. Das Rauchrohr ist hier nicht sichtbar, es führt wohl direkt hinter dem Herd in den Kamin. Zum ehemaligen Herdfeuer gehörten die beiden Steinkonsolen links und rechts, auf denen man kleine Dosen o.ä. abstellte, und die beiden Messingtürchen – hier sehen sie schwarz aus- darüber. Sie verdeckten kleine Nischen in der Wand, in denen ebenfalls allerlei unterzubringen war. Das oben sichtbare Mauerwerk ist eine Attrappe, es handelt sich um eine Tapete. Die Wände des an den Deckenbalken aufgehängten Bosens mussten leicht sein und waren ursprünglich aus lehmbestrichenem Flechtwerk. Auch der Fußboden dürfte ein Kunststoffbelag sein. Das Foto lässt aber auch die Vermutung zu, dass es sich um Steinplatten handelt. Ebenso ist das „Volängsken“ (Volant) am Rauchfang eine neuere Schmuckzugabe. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Bäuerliche Hofspeicher im Münsterland
|
Wenn man heute etwas von einem Speicher oder vom Speichern hört, denken viele zunächst an den Computer, seine Festplatte und die mobilen Datenträger. Aber davon ist hier nicht die Rede, auch nicht vom Dachboden, der bei uns „Up´n Balken“ heißt, in manchen Gegenden aber ebenfalls Speicher genannt wird. Am „Tag des offenen Denkmals“, dem 10. September dieses Jahres, geht es in Rinkerode um den fast 130 Jahre alten bäuerlichen Hofspeicher der Familie Voss-Weckendorf in Eickenbeck. Er gehört zur jüngeren Generation der Speicher und hat nichts mehr von der auch heute noch hin und wieder anzutreffenden burgenhaften Verschlossenheit mittelalterlicher Wehr- und Fluchtspeicher an sich, die durchweg Borg genannt wurden, weil sie ursprünglich zum Bergen (daher Borg) der Wertsachen in Notzeiten dienten. Einige von ihnen verfügten über einen Wohnraum, und wenn auch noch eine Kaminfeuerstelle eingebaut war, nannte man sie Kaminade oder Kemenade. Alfons Eggert und Josef Schepers haben in ihrem sehr informativen Buch „Spieker, Bauernburgen, Kemenaden“ die verschiedenen Arten dieser turmartigen Bauten mit fast quadratischem Grundriss dargestellt und sich auch mit dem Typ des Speichers auf dem alten Hof Schürmann (Voss-Weckendorf) befasst. Ein Speicher dieser Art stand in der Nähe des Hauseingangs, der in der Regel in die Küche führte. Die Bäuerin hatte in seinem Erdgeschoß den Backraum (Backs = Backhus) und alle notwendigen Geräte in nächster Nähe, den Ofen, den Backtrog, einen großen Tisch zum Formen der Brote, Brotschieber und Aschenkratzer, dazu natürlich zum Heizen Buchen- und Birkenholz und Reisig, das hierzulande Buschken (mit langem u) genannt wird. Vor rund fünfzig Jahren sah man noch auf jedem Hof einen 2 bis 3 Meter hohen Buschkenstapel, der im Laufe des Jahres immer kleiner wurde, bis er im nächsten Winter durch neues Buschkenbinden wieder aufgefüllt wurde. Im Backs wurden auch Äpfel, Pflaumen und Birnen gedörrt und Knabbeln aus zerbrochenen, frisch gebackenen Stuten (Weißbrot) in der Restwärme des Ofens getrocknet. Wenn der Speicher einen Keller besaß, dann war er wegen des fast überall hohen Grundwassers nur drei oder vier Stufen tief. Aber er war kühl und seine kleinen Fenster wurden durch dichte Sträucher zusätzlich beschattet. Im Speicher konnten auch Schinken, Würste und Speck geräuchert oder zum Trocknen aufgehängt werden. Seinen Namen verdankt der Speicher natürlich dem Lagern des geernteten Getreides auf dem Kornboden, zu dem eine Treppe mit mehreren Stufen hinaufführte. Er wurde am Dreschtag beladen von einem Mann, der sich den an die zwei Zentner schweren Sack mit Getreide auf den gebeugten Rücken packte und die Treppe hinauftrug, ihn dabei mit einer Hand geschlossen hielt und über den Kopf auf den Kornboden ausschüttete. Da der Dreschkasten einen Aufzug zum Anheben der vollen Säcke besaß, war das Aufbuckeln etwas leichter, aber immer noch schwer genug. Natürlich konnte man mit dem Aufzug hoch oben im Giebel die Säcke hinaufziehen, das war bequemer, aber das Aufsetzen und Zubinden der Säcke, ebenso das Absetzen und Öffnen dauerte auch länger. Und am Dreschtag hatte man wenig Zeit. Das aufgehäufte Getreide musste später alle paar Tage umgeschaufelt werden, damit es nicht muffig und schimmelig wurde. Dadurch entstand viel Staub. Um ihn leichter abziehen zu lassen, hatte der “Kornbürn“ mehrere Fenster. Der Speicher war zweigeschossig mit einem Dachboden, der meistens als Abstellplatz für alles Mögliche diente. Hier konnte man auch durch eine kleine Eisentür den Schornstein reinigen. Nicht alle Höfe besitzen heute noch einen Speicher. Die Wirtschaftsverhältnisse haben ihn überflüssig gemacht. Mancher Hof weiß auch mit ihm so recht nichts anzufangen und gibt kein Geld aus zu seiner Erhaltung und Pflege. Einige Speicher sind erweitert und als Viehställe eingerichtet oder zu Garagen umgebaut worden. Wenn sie mit ihrer Längsachse rechtwinklig zum Wohnhaus standen, wurden sie gelegentlich mit diesem durch einen Zwischenbau verbunden, so dass sie heute nicht mehr erkennbar sind, besonders dann nicht, wenn die Fassaden einander angeglichen wurden. Aus anderen entstanden rustikale Mietwohnungen für Liebhaber bäuerlichen Fachwerks oder wurden zum Alter-Teil für die Eltern. Die Familie Voss-Weckendorf und der Heimatverein Rinkerode stellen am diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ mit dem Speicher ein Stück Wirtschafts- und Kulturgeschichte von erheblicher Bedeutung vor. Eine Fotoausstellung und ein historischer Abriss werden das Denkmal erläutern. Daneben gibt es einen Kreativmarkt. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Was geschah mit dem Ascheberger Geburtsglöckchen 1945
|
Was 1945 mit dem Ascheberger Geburtsglöckchen geschah, ist nicht sicher belegt. Aber man weiß, dass es aus dem Dachtürmchen der Schule herausgenommen und nach Herbern gebracht wurde. Die Benedikt-Kirche dort hatte ihre Glocken abgeben müssen, und die Pfarrgemeinde hängte die „Geburtsglocke“ auf, um wenigstens den Beginn der Gottesdienste durch bescheidenes Läuten ankündigen zu können. Da die kleine Glocke einen Text trug, den man durchaus tolerieren konnte „Mensch ist der Menschen Freude“ und sonst keine nationalsozialistischen Zeichen, dürften keine Bedenken gegen die Verwendung in einer Kirche bestanden haben. Sie sollte ja nur eine Notzeit überbrücken. Die Man-Rune, die den Nazis als Zeichen für Geburt und Menschsein galt, sah einem christlichen Gabelkreuz, z.B. dem bekannten Coesfelder Kreuz, zum Verwechseln ähnlich. Wenn man hier und da die überflüssigen Hakenkreuzfahnen zerschnitt und zu kleinen Fronleichnamsfähnchen umarbeitete, dann konnte man mit einem Nazi-Glöckchen ohne weiteres vergleichbar verfahren. |
 |
|
1948 konnten die Herberner neue Glocken anschaffen und die kleine Glocke wieder abgeben, allerdings nicht nach Ascheberg, wo man ebenfalls schon ein neues Geläut besaß, sondern nach Angelmodde an die neue St.-Ida-Kirche. Ein Herberner Lehrer vermittelte die Übergabe. Eines Tages wurde die Glocke auch in Angelmodde entbehrlich, weil auch St. Ida ein größeres Geläut anschaffen konnte. Heute steht sie ohne Klöppel, also unbenutzbar, in der Kirche St. Bernhard in Angelmodde. Die Pfarrgemeinde denkt daran, sie zu reparieren und in der Hauskapelle eines Seniorenheims zu verwenden. Da die für 1939 gegossene Glocke von Petit & Gebr. Edelbrock schon im November 1938 geliefert wurde, installierte man sie sofort und ließ die Zeitung ausführlich darüber berichten. Da war die Rede von „Gläubig dienen wir der Erde und dem großen deutschen Werde“ und „Deutsche Jungen und Mädchen, denkt daran, dass in euch das Blut aus Urväterzeiten fließt“. Es war der entsetzliche Monat November 1938, in dem die Nazis mit der Zerstörung der Synagogen ihr Mordprogramm gegen die jüdischen Bürger Deutschlands begannen. Das Geburtsglöckchen an sich war vor diesem Hintergrund ein friedliches Ding und ebenso das Glockentürmchen, das in gleicher und ähnlicher Form in den Jahren zwischen den Weltkriegen ein beliebtes Architekturdetail war. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die 1903 an der Kirche abgebrannten Häuser
Am 4. Juli 1903 gerieten die auf dem Plan mit den Nummern 5, 6, 7 und 8 bezeichneten Häuser am Vormittag in Brand und wurden im Laufe des Tages völlig zerstört. Die Eigentümer waren:  Nr. 5 der Müller Drees Nr. 5 der Müller Drees  Nr. 6 der Kaufmann Rüschenschmidt Nr. 6 der Kaufmann Rüschenschmidt  Nr. 7 der Maurer Schwipp Nr. 7 der Maurer Schwipp  Nr. 8 der Wirt, Bäcker, Bierbrauer und Kornbrantweinbrenner Heinrich Forsthoff. Nr. 8 der Wirt, Bäcker, Bierbrauer und Kornbrantweinbrenner Heinrich Forsthoff. Da Forsthoff wenige Meter weiter östlich ein großes Grundstück besaß, errichtete er dort seinen Neubau, der heute noch an der gleichen Stelle steht. Die übrigen Häuser bekamen vom Grafen von Galen Bauplätze an der Dieningstrasse angeboten, die sie auch erwarben, ausgenommen die Familie Rüschenschmidt, die das Dorf verließ und ihr Haus am heutigen Weg "Im Pöpping" am Emmerbach errichtete, denn die Galenschen Grundstücke waren für drei Häuser zu klein. Graf Galen stiftete das Geld der Kirchengemeinde, die damals eine Erweiterung der Kirche nach Osten plante. Hinter dem Chor der Kirche standen neben dem abgebrannten Haus Forsthoff noch zwei Häuser, die aber vom Feuer verschont blieben. Eins davon steht dort heute noch: die sog. Begegnungsstätte (wurde bereits abgerissen - Anm. der Redaktion). Es gehörte 1903 schon der Kirchengemeinde und war vermietet. Das andere Haus hat noch Jahrzehnte gestanden. Zuletzt war darin das Elektro-Geschäft Hattrup, bevor sein heutiges Haus an der Sandstraße gebaut war. Dieses Haus gehörte der Familie Bultmann (Textilgeschäft) Sie erwarb später das Haus des jüdischen Textilkaufmanns Samson Wolff, der schon lange vor der Verfolgung durch die Nazis Ascheberg verließ. Heute ist das große Haus fast zu einer Ruine geworden (wurde bereits ebenfalls abgerissen - Anm. der Redaktion). Auch das Haus Nr.4, die Vikarie neben dem Pfarrhaus, brannte nicht ab. Als 1923/24 das heutige Pfarrheim, damals Vereinshaus genannt, gebaut wurde, brach man das baufällige und unbewohnte Haus ab. Das in weißschwarzem Fachwerk errichtete Haus der Kirchengemeinde besteht aus vier Teilen, die an die ehemaligen Häuser an dieser Stelle erinnern. Auch die alte Kaplanei (Nr.2) steht heute nicht mehr. Sie musste dem neuen Weg vom Kirchplatz zum Katharinenplatz weichen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Ascheberger Altar
|
Als die 1524 eingeweihte Kirche im Jahre 1740 endlich einen Chorraum erhielt, bekam sie auch einen neuen Altar im damals herrschenden Barockstil. Er blieb für rund 140 Jahre der Mittelpunkt der Kirche, bis er 1885 durch einen neuen Altar im Stil der wiederbelebten Gotik ersetzt wurde. Dieser Altar wurde für die heute älteren Katholiken „unser Altar", und viele bedauerten, dass er 1959 dem heutige weichen musste. Damals war zuerst ein moderner Altar im Gespräch. Doch die Pfarrgemeinde kaufte dann, angeregt durch einen Hinweis von Baron Landsberg, einen von der Diözese Paderborn in Holland ersteigerten Barockaltar aus Amersfoort. Aber er erwies sich für die Ascheberger Kirche als zu niedrig und das mitgelieferte Bild für den Raum zwischen den Säulen als zu klein. In Amersfoort war der leere Platz rund um das Bild durch eine breite Umrahmung ausgefüllt gewesen, die aber nicht mehr vorhanden war. Deshalb kam man auf den wenig glücklichen Gedanken, einen gefalteten blauen Vorhang hinter das Bild zu hängen, so dass die leeren Stellen kaschiert waren. Damit galt dieses Problem als vorläufig gelöst, aber zufrieden konnte man nicht sein. |
 |
|
Um den Altar aufzustocken, damit er an das Gewölbe heranreichte, hatte man eine wesentlich bessere Idee: Man stellte ein Gottvaterrelief mit Putten, das noch von dem alten Barockaltar übrig geblieben war und bei der Familie Gisa-Frenking aufbewahrt wurde, auf den oberen Abschluss. So ist es heute noch. Am 20. Dezember 1959, einem Sonntag, wurde der Altar durch Dechant Hörster, Bockum-Hövel, eingeweiht. Pfarrer Heinrich Plugge war damals krank und wurde in der Raphaelsklinik behandelt. Der Altarraum hatte ein völlig neues Gesicht bekommen. Der gotische Altar war so niedrig gewesen, dass man 1885 über ihm ein großes Fenster in die Chorwand gebrochen hatte, das nun wieder zugemauert worden war. Von nun an fehlte das vertraute farbige Sonnenlicht, das besonders im Sommer schon bei der Frühmesse den Chorraum verklärt hatte. Auch die Wandmalerei war mit weißer Farbe überdeckt worden. Chorgestühl und Kommunionbank wurden ausgetauscht. Alles wirkte reichlich fremd und ungewohnt. Die festlichen Weihnachtstage 1959 überstrahlten aber zunächst alles, und danach musste man sich doch an das Neue gewöhnen. Das fiel den jungen Leuten wesentlich leichter als den alten. Hilfreich war dabei, dass amtlich mitgeteilt wurde, der alte Altar sei künstlerisch wertlos gewesen. Mit dieser zeitbedingten Meinung trösteten sich manche Ascheberger noch lange. Auch der blaue Vorhang hinter dem Altarbild verschwand eines Tages, denn 1962 kaufte die Pfarrgemeinde ein etwas größeres Bild, eine Kreuzabnahme von einem unbekannten Maler, das die Gemeinde Kirchhundem im Sauerland anbot. Die obere Seite war als Dreipass ausgebildet, so dass wieder oben rechts und links leere Stellen entstanden. Schon 1962 schlugen die Architekten Kösters und Balke vor, dort Rosetten anzubringen, um diese absolut „unbarocken Löcher" zu füllen, aber dazu kam es bis heute nicht. |
 |
Das holländische Altarbild, das Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen darstellt, wurde auf die Orgelbühne gehängt. Dass es von dem holländischen Maler Abraham Bloemaert (1564 -1651) stammte, wusste damals niemand. Erst 1994 meldete sich der Kunstwissenschaftler Dr. Guido Seelig aus Berlin, der von dem bis dahin für verschollen gehaltenen Bild gehört hatte, und identifizierte es als ein Bloemaert-Werk. 1996 bestätigte der Genfer Professor Dr. Marcel Röthlisberger diese Diagnose. Das Bild stammt von 1605 und der Altar von 1696, gehörten also ursprünglich nicht zusammen. Fast ein halbes Jahrhundert steht der neue Altar, der übrigens fast 200 Jahre älter ist als sein Vorgänger, jetzt schon in der St. Lambertus-Pfarrkirche. Er ist allmählich zu einem alten geworden, jedenfalls für viele, denn immer weniger Ascheberger können sich an die Zeit vor 1959 erinnern. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Dorfbach
|
Von Südwesten her strömte ein wasserreicher Bach auf den Ascasberg, den heutigen Kirchplatzhügel, zu, wurde von ihm gebremst, in einem Winkel von ca. 120 Grad nach Norden abgelenkt und floss dann ziemlich geradeaus in den Emmerbach. An den Ufern dieses Baches reihten die ersten Ascheberger ihre Häuser aneinander, bauten Brücken und nutzten das Wasser, wie immer es möglich war, auch für Abwässer. Für Fäkalien hatte jedes Haus seine Sammelgrube, Der Bach und seine Seitenwege erhielten zusammen den Namen Sandstruot. Struot (Strut, Strot, Strat) – vielleicht mit strömen verwandt – muss damals eine Bezeichnung für fließendes Wasser gewesen sein. Im Laufe der Zeit setzte sich für Struot wahrscheinlich wegen der Uferwege das sehr ähnliche Wort Straot (Straße) durch, und „Sandstraße“ wurde zum Namen für den Bach und die Seitenwege, den wichtigsten Verkehrsstrang im Dorf. Ob die Silbe Sand den Sand im Bachbett meinte – was nur Sinn hätte, wenn er hier ungewöhnlich auffällig gewesen wäre – oder als damals noch geläufiges Wasserwort die übliche Bezeichnung für so eine Strut war, ist nicht bekannt. Den Plattsprechenden fällt hier auf, dass man mit „Struot“ auch die Luft und Speiseröhre bezeichnet, „dat Halslock“, einen ebenfalls wichtigen Verkehrsstrang! |
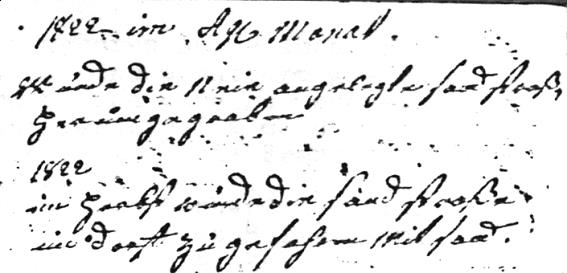 |
|
Im Jahre 1822 wurde der mittlere Teil des Baches zugeschüttet und zwar von St. Georg bis zur Lüdinghauser Straße. Der Name Sandstraot blieb aber bestehen für die ehemaligen Seitenwege, die nun die breitere, bequemere und ungefährlichere Sandstraße bildeten. Der heimatkundlich interessierte Pfarrer Jodokus Fechtrup (von 1933 bis 1954 in Ascheberg tätig - siehe auch Tagebuch) stellte fest, dass der alte Bach zuweilen „recht böse“ werden konnte und es deshalb in der Sandstraße „ungemütlich“ gewesen sei. Fechtrup hat noch alte Leute gekannt, die von ihren Großeltern davon gehört hatten. Man war 1822 wohl erleichtert, den Bach endlich los zu sein. Allerdings trockneten allmählich auch die von ihm gespeisten Kirchengräften aus und wurden ebenfalls zugeschüttet. Schwieters und Tibus scheinen von alledem nichts gewusst zu haben, obwohl sie um 1870/80 noch Zeitgenossen dieser Vorgänge gekannt haben können. Auch wir wissen heute vom alten Sandstraßenbach nur von einer zufällig erhaltenen Notiz des Kaufmanns Bernard Bose vom Kirchplatz, der die Arbeiten an dem Bachbett beobachtet und sich einige Sätze aufgeschrieben hat. Bose schrieb, „die Sandstraße“ sei „umgegraben“ (herumgegraben um das Dorf) worden und meinte damit, dass man ein neues Bachbett vom heutigen St. Georg aus quer durch das heutige Friedhofsgelände westlich am Hof Rohlmann vorbei zur Lüdinghauser Straße und an dieser entlang bis zur Sandstraße gegraben habe, wo der Bach noch offen war. Ab hier floss er nach Norden am Melkpatt entlang zum Emmerbach. Bose schrieb wörtlich: (siehe Bild oben) 1822 im Ag Monat wurde die neu angelegte Sandstrasse Herumgegraben. 1822 im Herbst wurde die Sandstraße im Dorf zugefahren mit Sand. Er bezeichnete den Bach selbst und auch die neue bachlose Straße als „Sandstraße“. Bis 2004 war dieser westlich um das Dorf „herumgegrabene“ Bach zwischen der Adamsgasse am südöstlichen Friedhofseingang und der Lüdinghauser Straße (gegenüber Aldi) noch offen. Dann wurde dieses Stück zugeschüttet, nur das teichartig ausgeweitete nördliche Ende ist offen. Er war nur ein schmales Bächlein, denn der erst in jüngster Zeit angelegte Eschenbach westlich des neuen Friedhofs nahm ihm das meiste Wasser ab. Auch dieser wird vermutlich bald verroht oder ganz zugeschüttet. Das Wasser im Dorf ist nicht mehr „böse und ungemütlich“ (so Pfarrer Fechtrup vor rund 60 Jahren), denn in den Bauerschaften sind breite Vorfluter ausgebaggert worden, die das Wasser schnell zum Emmerbach, zum Teufelsbach, zum Beverbach und anderen weiterleiten. Da sich bislang in keinem Archiv ein Hinweis auf die Umlegung des Baches im Sommer 1822 gefunden hat, ist Bernard Boses kleine Notiz für Ascheberg-Dorf von größtem Wert. Leider ist das Original nicht aufzufinden, so dass wir uns mit einer alten Fotokopie behelfen müssen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Teufelsbach
|
In den Sommermonaten sind ungezählte Radfahrer auf den Wirtschaftswegen und Straßen rund um Ascheberg unterwegs. Die meisten fahren, um die Sonne, die frische Luft und die Landschaft zu genießen, einige aber haben darüber hinaus ein heimatkundliches Interesse an dem, was rechts oder links des Weges zu sehen ist oder vor Zeiten einmal zu sehen war. Wer ortskundig ist, hat es da leichter, aber auch er weiß zuweilen keine Antwort, wenn Besucher sich über dieses und jenes wundern und entsprechende Fragen stellen. Das ist häufig der Fall bei der Deutung der alten Flurnamen, die in den vergangenen Jahren teilweise zu Wegenamen geworden und auf den Straßenschildern zu lesen sind. Andere, zum Beispiel die Namen der kleinen Bäche, finden sich weder auf Hinweisschildern noch auf Wanderkarten und erregen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie, meist nebenbei, von den Einheimischen genannt werden. Zu ihnen gehört der Teufelsbach in der Lütkebauerschaft, den die Kartographen hier unbenannt gelassen haben und der erst in Nordkirchen unter diesem Namen in Erscheinung tritt. Er beginnt an der Anhöhe südlich der Broksenke zwischen der Eisenbahn und der Lütkestraße und mündet in der Lüdinghauser Bauerschaft Ermen in die Stever. Nach seiner Quelle zu suchen, ist vergebliche Mühe. Obwohl sein anfangs sehr bescheidener Wasserlauf auf den durch die Flurbereinigung nicht betroffenen Arensbergschen Ländereien beginnt, ist außer einem kleinen Zufluss aus den Fischteichen an der Eisenbahnbrücke nur eine sehr verlandete Kuhle zu entdecken, die vielleicht aber eine Quelle enthält. Südlich des Hofes Rengshausen, heute, beginnt die Regulierung des Teufelsbaches. Etwas verschämt rinnt er am Boden seines breiten Baggerbettes dahin. Er unterquert in einem Betonrohr die Eisenbahn und fließt südlich der Galghege nach Westen. In der Nähe der Straße Ascheberg – Nordkirchen erreicht er die Nordkirchener Bauerschaft Piekenbrock, deren Name viel über das einst besonders nasse, weil zwischen Anhöhen gelegene, dünn besiedelte Gebiet preisgibt („Piek“ – gesprochen Pierk – bedeutet „klebrige Schmiere“). Von den weiteren Anliegern soll hier nur noch die Familie Krömann in Piekenbrock genannt werden, weil ein Sohn dieses Hofes vor 135 Jahren mit Frau und Tochter auf dem Hof Dartmann, wo er sich eingeheiratet hatte, in der Rinkeroder Davert ermordet wurde. Weder Mörder noch Tatmotiv sind bis heute bekannt. Nördlich von Nordkirchen stand einst die Meinhöveler Mühle am Teufelsbach. Sie ist verschwunden, die alte gemauerte Brücke der Straße nach Ottmarsbocholt ist aber noch zu sehen. Dort wo in der Bauerschaft Ermen bis ins 19. Jahrhundert hinein die Burg Alrodt stand, mündet der Teufelsbach in die Stever. Ein Gedenkstein, den der Heimatverein Ermen aufgestellt hat, erinnert an diese Burg. Hier befindet sich auch die letzte Brücke des Teufelsbaches, bis vor kurzem eine Holzbrücke, die das Befahren mit Fahrzeugen durch lautes Poltern hörbar machte wie in alten Zeiten. Sie ist durch eine Betonbrücke ersetzt worden. In einem spitzen Winkel stoßen Teufelsbach und Stever zusammen. Die niedrig gelegene Wiese an der Mündung war wohl einst ein Stück eines größeren Überschwemmungsgebietes, das im Mittelalter gerodet wurde und der damals gegründeten Burg ihren Namen gab: Alrodt = Rodung am Wasser. „Al“ bedeutet Nässe, im plattdeutschen „Al“ = Jauche ist es noch enthalten. So hat das kleine Bächlein aus der Ascheberger Lütkebauerschaft zusammen mit der Stever der Burg in Ermen zu ihrem Namen verholfen. Die erste Teufelsbach-brücke ist übrigens ein Zementrohr südlich von Rengshausen. Was aber bedeutet der etwas drohend klingende Name? Natürlich nichts Schlimmes. Er entstand durch eine Verständigungsschwierigkeit. Als die preußischen Kartographen Leutnant von Czetteritz und Leutnant von Glaeser vom 11. Husarenregiment im Jahre 1841 das Land um Ascheberg, Nordkirchen und Lüdinghausen auf ihren Messtischen zu Papier brachten, fragten sie natürlich nach dem Namen des Baches und erhielten zur Antwort: Düwelsbierk. Da die hochdeutsch sprechenden Herren mit diesem plattdeutschen Wort nichts anfangen konnten und wohl auch nicht durften – schließlich waren sie beauftragt, eine allgemein verständliche Kartographie für militärische Zwecke herzustellen -, ließen sie sich den Bachnamen wörtlich übersetzen: „Teufelsbach“. Das klang richtig, war aber falsch. Denn weder die benachbarten Bauern noch der zusätzlich befragte Pfarrer oder Lehrer im Dorf wussten genügend oder überhaupt etwas vom Ursprung der Flurnamen. In „Düwel“ steckt die Silbe „div“, die mit ihren Varianten „dev-dav-dov-duv“ in einer Reihe von Flur- und Ortsnamen vorkommt und immer auf ein Feuchtgebiet hinweist, so auch in Davert und Deventer und wahrscheinlich auch Dover. Das norwegische Wort „dyvel“ bedeutet „Wasserlache“. In Holland und England haben die Forscher verwandte Bezeichnungen gefunden. Hätten die Bauern 1841 den Kartographen die Bachnamen „Dawelsbierk“ oder „Dowelsbierk“ genannt, dann hätten diese eben Dawelsbach oder Dowelsbach eingetragen. Denn Düwelsbierk war schon damals die volkstümliche Umdeutung eines unverstandenen, weil im Laufe von Jahrhunderten mündlich überlieferten und entsprechend umgeformten Namens. Außerdem konnte man sich unter einem Düwel etwas vorstellen. Von ihm war in der Kirche, in der Schule und zu Hause oft die Rede. Dass sich keine plausible Verbindung zwischen dem Teufel und dem keineswegs bösen Bächlein herstellen ließ, störte niemanden. Es war eben so. Teufelsbach-Nachbar Anton Höhne erinnert sich: Wi seggen fröher ümmer Düwelsbierk. De war so schmal, dao wäörs mit eenem Tratt drüöwer!“ (Wir sagten früher immer Teufelsbach. Der war so schmal, dass man mit einem Tritt hinüber war) Wer will, kann mit dem Fahrrad dem Lauf des Teufelsbaches folgen, zwar nicht von der Quelle bis zur Mündung und auch nicht Meter für Meter, aber doch von der Galghege bis zur Burgstelle in Ermen. Dazu benötigt man aber eine Wanderkarte. Der Bach selbst ist etwa zwölf Kilometer lang. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Johann Conrad Schlaun
|
Im Schlaun-Jahr 1995 stellte man sich überall im Münsterland die Frage: War er auch bei uns tätig? Für Ascheberg heißt die Antwort: Ja, er hat auch hier einige Pläne entworfen, aber bedauerlicherweise nur einen einzigen davon ausgeführt. Doch wo findet man hier etwas von ihm? Ein Rundgang durch Dorf und Bauerschaften hinterlässt die Erkenntnis: Kein Gebäude, nicht einmal ein Bildstock mit Schlauns Handschrift ist zu entdecken! Trotzdem hat er in Ascheberg seine Spuren hinterlassen. Aber sie sind schwer zu finden, obwohl ein damals sehr bedeutender Mann ihm einen Bauauftrag erteilt hat, nämlich Graf Ferdinand von Plettenberg, Minister des Fürstbischofs Clemens August von Wittelsbach und Schlossherr in Nordkirchen. |
 |
|
Dieser machtliebende Herr hatte das Patronat über die Kirche in Ascheberg erhalten, als er das mit Nordkirchen verbundene Haus Davensberg erwarb. Obwohl ihn sein politischer Ehrgeiz nach Wien zog, planten er und seine Frau Felizitas von Westerholt-Lembeck, ihr Erbbegräbnis in Ascheberg einzurichten, und zwar im Chor der Kirche. Das aber musste erst noch erbaut werden, denn die Kirche war bisher ohne Chor geblieben. Bei dieser Gelegenheit sollte sie auch eine neue Sakristei und endlich einen ansehnlichen Turm bekommen, denn der aus dem Mittelalter stammende war reichlich bescheiden und schadhaft. Also entwarf Schlaun, seit 1725 Leiter der Schloßbaustelle in Nordkirchen, einen „Plan Vom Thurn der Kirchen und neuen Chor Zu Ascheberg, Wie auch der Sachristey“, zeichnete dazu das „Profil der Kirchen, Chor und Sachristey Zu Ascheberg“ und eine „Aufführung vom Thurn, wie Selber Könte Erneuert werden Zu Ascheberg“. Diese Pläne befinden sich im Landesmuseum in Münster. Schlaun erbaute zunächst den Chorraum und vollendete ihn 1740. Im Jahre 1737 starb sein Auftraggeber Ferdinand von Plettenberg in Wien und wurde auch dort begraben. Seine Witwe Felizitas von Westerholt-Lembeck ließ nun die weiteren Arbeiten in Ascheberg einstellen. Der Turm wurde nicht gebaut, und auch vom Erbbegräbnis war nicht mehr die Rede. |
|
Schlaun hatte einen barocken Hochaltar mit den Figuren der Kirchenpatrone Lambertus und Katharina entworfen, der auch errichtet wurde. Er musste 1885 einem neugotischen Altar weichen, und die Figuren wurden verkauft. Die Hl. Katharina stand 25 Jahre im Konferenzzimmer des Pfarrhauses. Am Katharinentag 2004 brachten Eltern, Kinder und Erzieherinnen sie in einer kleinen Prozession in den Kindergarten St. Katharina. Das Gottvaterbild mit Putten ist heute sogar noch in der Kirche. Es hatte die Zeit der Neugotik (etwa von 1880 bis 1960) bei der Familie Frenking im Breil überdauert und wurde im Jahre 1959 auf den in Holland erworbenen Barockaltar gesetzt, weil dieser etwas zu niedrig war. Erhalten ist auch noch das Wappen der Stifter. Schlaun hatte dafür die Stelle über dem Chorbogen vorgesehen. Da ist es auch heute wieder, nachdem es zur Zeit der neugotischen Ausstattung in der Sakristei untergebracht war. Dass Schlaun den Turm nicht mehr bauen konnte, ist sehr bedauerlich, denn er wäre mit seinem Ziegelmauerwerk, den Sandsteinlaibungen und –bögen und dem schiefergedeckten Zwiebeldach eine sehr harmonische Ergänzung des spätgotischen Kirchenhauses geworden. Ein Modell der Kirche mit dem Turm von Schlaun war 1974 in der Ausstellung zum Jubiläum „450 Jahre St. Lambertus Ascheberg“ und auch 1990 bei der 1100–Jahr–Feier der Gemeinde zu sehen. Es beweist Schlauns Sinn für wohltuende Proportionen. |
 |
|
Von seinen Architekturplänen wurden nur der Chorraum und eine schlichte Sakristei verwirklicht. Aber selbst der Bauhistoriker wird nur mit Mühe Schlauns Anteil am Chor erkennen. Er hat es dem spätgotischen Kirchenbau sehr sorgfältig angepasst, indem er ein Kreuzrippengewölbe einbaute, das auf vier jeweils doppelten Pilastern ruht. Je ein großes Rundbogenfenster mit farbloser Verglasung befindet sich an der Nord- und Südseite. Schlaun in Ascheberg? Ja, aber leider größtenteils nur auf dem Papier. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Bach in Rohlmanns Weide
|
Im Sommer 2004 wurde der Bach, der das Wohngebiet Rohlmanns Weide von der Adamsgasse zur Lüdinghauser Straße durchquert, verroht. Nur eine schmale, überflüssig gewordene Brücke, die vermutlich demnächst abgebaut werden wird, und ein leicht verbreitertes Stück an der Lüdinghauser Straße erinnern noch an ihn. Ein zweiter Bach, der Eschenbach an der Westseite des Friedhofs ist (noch) offen, soll aber demnächst ebenfalls verroht und zum Parkplatz werden. Während dieser Bach noch relativ jung ist, gibt es den namenlosen, aber gelegentlich als Dorfbach bezeichneten Wasserlauf im Wohngebiet Rohlmanns Weide seit 182 Jahren, seit 1822. Er ist ein Bach, der durch ein mit Schaufel und Spaten gegrabenes Bett fließt, müsste also eigentlich als Graben bezeichnet werden, aber als Graben, der einen früheren Bach ersetzt hat. |
 |
|
Dieser frühere und ursprüngliche Bach kam aus den südwestlichen Bauerschaften Westerbauer, Hegemer und Lütkebauer und floss an der Nordkirchner Straße entlang mitten durchs Dorf, nämlich durch die Sandstraße und am heutigen Melkpatt entlang zum Emmerbach. Die Ur-Ascheberger haben sich an seinen Ufern niedergelassen und dort, wo der Bach vor einem leichten Hügel nach Norden abbiegt, auf diesem Hügel ihre Kirche, vorher vielleicht eine vorchristliche Opferstätte, gebaut. Der Bach wurde plattdeutsch Sandstraot genannt. Straot bedeutet hier nicht Straße, sondern schmaler Durchgang und findet sich in unserem plattdeutschen „Struot“, was Halsloch (Luft- und Speiseröhre) bedeutet, wieder. Da sich aber diese Namen sehr ähneln, hielt man sie nicht auseinander. Der Bach wurde von Seitenwegen begleitet und war an mehreren Stellen überbrückt. Auch diese Wege wurden Sandstraot, aschebergisch Sandstraut, genannt. Dass „Straße“ aus dem lateinischen strata via (geebneter Weg) entstanden ist, und nichts mit dem indogermanischen „Strot, Strat, Strut“ (wie z.B. im Flurnamen Unstrut) zu tun hat, wusste außer den Lateinkundigen niemand und interessierte auch niemanden. Mag sein, dass „Sand“ auf das Vorkommen von echtem Sand hinweist, den es hier unter der Straße ja reichlich gibt. Vielleicht aber ist damit das vorgermanische Wasserwort „Sand/Sant“ gemeint, dass Bestandteil vieler Namen von Orten und Fluren ist, wo man keinen oder nur so wenig Sand findet, dass er nicht namengebend gewesen sein kann. Im Sommer 1822 war man der unbequemen und nicht ungefährlichen Straßenbach leid und verfüllte ihn auf dem Stück zwischen dem heutigen Haus St. Georg und der Einmündung der Lüdinghauser Straße in die Sandstraße. Natürlich musste man dem Wasser ein neues Bett und einen neuen Verlauf geben. So grub man einen Graben über das Gelände des heutigen Friedhofs und durch Rohlmanns Weide zur Lüdinghauser Straße. Wir müssen dem Ascheberger Kaufmann Bernard Bose vom Kirchplatz dankbar sein, dass er im August 1822 das Zuschütten des alten Sandstraßenbachs und das Anlegen des neuen Bachbettes westlich um das Dorf herum notiert hat. Von der Existenz des Baches wussten früher viele Ascheberger aus den Berichten ihrer Großeltern. Aber wann und wie der Bach verschwand, war nirgends zu erfahren. Auch Schwieters erwähnt ihn nicht, obwohl er um 1880, als seine Bücher entstanden, durchaus noch einige Augenzeugen dieses für die Entwicklung des Dorfes sehr bedeutenden Ereignisses gefunden hätte. Die heute auffällige teichartige Ausweitung des Bachrestes an der Lüdinghauser Straße erinnert an die ehemalige „Waschanstalt“ (siehe Bild), wo die Hausfrauen sich mit der großen Wäsche abplagten. Vor wenigen Jahren sah man dort noch Stücke von den Stufen, auf denen sie beim Spülen in flachen mit Stroh gefüllten, an der Vorderseite offenen Holzkästen knieten. Ursprünglich war die Waschanstalt hinter dem Bistro auf dem Gelände der Fa. Bonkhoff eingerichtet. Dort war der Bach noch offen. Aber als die Ecke bebaut wurde, verlegte man den Spülplatz um einige Meter nach Westen, wo er noch den Hitlerkrieg überlebte. Vielleicht entschließt sich die Gemeinde Ascheberg, die kleine Holzbrücke und den Rest der Waschanstalt zu erhalten. Sie sind historische Baudenkmale, und sie dienen unserer Erinnerung. Der „gegrabene Bach“ selbst ist nun weitgehend in Rohren verschwunden. Man muss sich damit abfinden, aber man muss es wissen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Siegmund Spiegels Verstecke 1943-1945
|
Der jüdische Viehhändler Siegmund Spiegel aus Ahlen und seine Frau Marga Spiegel mit ihrer fünfjährigen Tochter Karin müssen sich am 23. Februar 1943 mit den anderen Ahlener Juden am Ahlener Schlachthof einfinden, angeblich um ihre Arbeitserlaubnisse überprüfen zu lassen, in Wirklichkeit um ins KZ abtransportiert zu werden. Die Familie Spiegel beschließt, sich irgendwo zu verstecken. Die Mutter Marga Spiegel kann mit dem kleinen Kind nicht dauernd in einem Versteck leben. Sie nennt sich Marga Krone und ihre Tochter Karin Krone und sie wollen sich als Evakuierte aus Dortmund ausgeben und behaupten, dass ihr Mann als Soldat im Krieg sei. Frau Marga Spiegel/Krone und ihre Tochter Karin können bei der Bauernfamilie Aschoff in Herbern unterkommen und sie bleiben dort bis zum Ende der Nazizeit. Der Mann Siegmund Spiegel kann seinen Namen nicht ändern, weil er total versteckt leben muss, denn er ist ja angeblich Soldat. Er will zunächst bei der Familie Sickmann in Werne wohnen, aber das ist zu gefährlich, weil das Haus an einer Hauptstraße liegt und leicht eingesehen werden kann. Deshalb lebt er vom 27. Februar 1943 bis zum 17. März 1943 bei einem Bauern in Dolberg, wo die Frauen die gefährliche Situation nicht länger aushalten und er das Haus verlassen muss, und bis zum 22. November 1943 bei der Familie Pentrop in Nordkirchen. Dann ist es auch dort für ihn zu gefährlich, denn es wird eine neue Heizung in den Wohnräumen eingebaut, und wegen der Bauarbeiten muss Spiegel die Zimmer ständig wechseln. Ein Pflichtjahrjunge beobachtet die geheimem Klopfzeichen des Herrn Pentrop, mit denen er Einlas in Spiegels Versteck bekommt. Der Junge macht das nach, und Spiegel öffnet ahnungslos. Der Junge scheint geschwiegen zu haben, aber Spiegel muss sofort an einen anderen Ort. Er fährt am 22. November 1943 mit seiner Frau und Herrn Pentrop in dessen Kutsche zu Willermanns nach Ascheberg, wo er aufgenommen wird. Dort erklärt er nicht, warum er den Hof Pentrop verlassen musste, denn der Zwischenfall mit dem Pflichtjahrjungen hätte noch böse Folgen haben können, die auch die Familie Willermann gefährdet hätte. Die Willermanns sind sehr besorgt und verängstigt, denn Spiegel muss in einem Zimmer im Obergeschoß untergebracht werden, das nicht besonders gesichert werden kann. Herr Willermann besucht Herrn Spiegel in seinem Versteck aus Angst überhaupt nicht, auch Frau Willermann hat große Angst. Aber sie bringt ihm das Essen und versorgt ihn mit dem Nötigen. Außer den beiden Willermanns ist nur die junge Anni Merten aus Werne, später Frau Hegemann, die hier als Angestellte arbeitet, über den versteckten Mann unterrichtet. Sie spricht aber nicht mit ihm und bringt ihm auch nicht das Essen. Am Tag vor Weihnachten 1943 besucht Frau Spiegel/Krone mit Kind ihren Mann bei Willermanns und erfährt, dass die Willermanns vor Angst nicht mehr ruhig leben können und Siegmund Spiegel bitten, das Haus sofort zu verlassen. Frau Spiegel schreibt später: „ Aber wer kann es ihnen verargen, dass sie ihr Wort nicht halten konnten – in einer Zeit, wo einer den anderen bespitzelte und keiner seinem Nachbarn trauen durfte? Wir können darüber nicht richten.“ Am Tag nach Weihnachten 1943 gingen Herr und Frau Spiegel in der Dunkelheit zu Fuß zum Hof Silkenbömer in Nordkirchen, der aber nicht weit vom Hof Willermann liegt. Spiegel hatte den Willermanns gesagt, er würde in eine andere Gegend gehen, um seine Spur zu verwischen. Vom 27. Dezember 1943 bis zum Ende der Nazizeit wohnt er beim Bauern Silkenbömer. Bei Willermann wohnte er vom 22.November 1943 bis zum 27. Dezember 1943. Das ergibt die Auswertung der Niederschrift von Frau Spiegel in dem Buch: Retter in der Nacht: Wie eine jüdische Familie in einem münsterländischen Versteck überlebte (Geschichte und Leben der Juden in Westfalen) (Marga Spiegel starb mit 101 Jahren im Jahre 2014.) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Ascheberger Ty
|
Nach den Akten des Reichskammergerichts im Staatsarchiv Münster stand ein Gerichtsstuhl des Gogerichtes Ascheberg-Davensberg auf dem Ty in Ascheberg. Hier wuchs eine Linde, und hier fanden vom 14. Jh. an zweimal, später viermal jährlich, eine Zeitlang sogar alle 14 Tage, die Gerichtsverhandlungen statt. Dr. Helmut Müller hat die Ascheberger Gerichtsgeschichte, die nicht leicht zu erfassen ist in seiner Ascheberg-Chronik von 1978 dargestellt. Nirgends ist jedoch überliefert, wo der Gerichtsplatz, der sogenannte Ty (auch Tie oder Thie geschrieben) zu finden ist. Man weiß allgemein, dass ein solcher Ort, auch als Freistuhl bezeichnet, auf einer Anhöhe lag, und mochte sie auch noch so niedrig sein. Er war von einer Mauer oder einem Kranz von dicken Steinen umgeben. Unter der Gerichtslinde nahm der Richter, Gograf genannt, Platz. Um 1390 stand der Freistuhl bei dem Hof Benningkamp, d.h. in Rohlmanns Weide. Die Adamsgasse steigt von der Sandstraße her leicht bergan und bildet etwa am Friedhofseingang einen kleinen Hügel. War hier der Ty? Da das Gogericht erst mit dem Ende des Fürstbistums Münster im Jahre 1802 aufgelöst wurde, könnten Reste des Gerichtsplatzes noch vorhanden gewesen sein, als die Preußen um 1820 begannen, das Münsterland topographisch zu erfassen und die Urkataster und Urmeßtischblätter anlegten, die uns heute wertvolle Hinweise geben auf die damalige Topographie unserer Heimat. Auf einem Übersichtshandriß der Flur XII von Ascheberg, genannt Dorf, die der preußische Katastergeometer Wissel im August und September 1826 gezeichnet hat, sind zwei, etwas größere freie Flächen am Kirchenhügel zu sehen, die vielleicht mit dem Ty in Verbindung gebracht werden können. Am Knotenpunkt von Appelhofstraße, Bultenstraße und Dieningstrasse ist eine rundliche Fläche eingezeichnet, rund 50 Meter im Durchmesser und mit Gesträuch und Gras bewachsen. Hier an der höchsten Stelle im alten Dorf könnte der Ty gewesen sein. Aber genau an der entgegengesetzten Seite der Kirche, an der Sandstraße beim Floriansbrunnen, ist ebenfalls eine Freifläche von ähnlicher Größe eingezeichnet. Hier fehlt zwar der Hügel, aber dafür ist eine Beziehung zum Gogericht gegeben, denn hier stand noch im 18. Jh. der Pranger und daneben das „Gerichtshäuschen“, das derbe und unverblümt „Kak“ genannt wurde. Hier floss auch bis 1822 von Westen her der Sandstraßenbach, der vor dem Kirchenhügel nach Norden abbog. Vielleicht war am Bachufer auch eine Wippe aufgebaut, mit der ein Bestrafter ins Wasser getaucht werden konnte. Für solche Aktionen war diese zentrale Stelle besonders geeignet. Es ist jedoch die Frage, ob nicht nur ein Gerichtsplatz, sondern auch ein Ort des Strafvollzugs als Ty bezeichnet wurde. Ty, (Tie, Thie, auch Thigg und Thyg, sogar Tee und Tei), geht nach Meinung von Fachleuten auf die indogermanische Wurzel dic zurück und ist im lateinischen dicere enthalten, auch in causam dicere, was Prozess führen bedeutet. Von da ist der Weg zur Bedeutung „Gerichtsplatz“ nicht weit. Aber auch „Land, das durch Gerichtsbeschluss als Gemeinschaftsland genutzt werden soll“, kann als Ty bezeichnet worden sein. Dabei dürften nicht nur die großen Allmenden gemeint sein, sondern insbesondere die Dorfplätze, also „öffentliche Verkehrsflächen“, die als Versammlungsplätze dienen sollten, z.B. zur Entgegennahme von obrigkeitlichen Anordnungen oder auch zur Beratung über Fragen, die nur in gemeinsamer Arbeit gelöst werden konnten, vielleicht auch zur Abgabe des Zehnten oder zum Verkauf von Vieh. Die die Ascheberger Dorfbauerschaft umgebenden Allmenden - das Altefeld ist die bekannteste - trugen ihre alten Flurnamen. Es ist aber möglich, dass auch sie gelegentlich Ty genannt wurden. So gesehen müsste es eine ganze Anzahl von Tys gegeben haben, unter denen der Gerichtsty der respektabelste war. Übrigens ist das Wort Ty erstmals 1120 im Soester Stadtrecht belegt. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Kreuzweg in St. Lambertus Ascheberg
|
Die vierzehn Kreuzwegbilder in unserer Kirche wurden 1879/80 von einem unbekannten, vielleicht in Remagen tätigen Maler gemalt, denn am 24. April 1880 quittierte dort ein uns nicht näher bekannter Josef Peter Schreiner den Empfang von 1200 Mark für diese Bilder. Kreuzwegbilder, die denen in Ascheberg sehr ähnlich sind, hängen z.B. auch in Herbern, Rorup, Sassenberg und (früher) Liesborn, so dass man vermuten könnte, sie stammten alle vom gleichen Maler. Das ist aber nicht der Fall, wie die Stilunterschiede beweisen. Der Roruper Kreuzweg ist 1873 von dem Oelder Kirchenmaler Johannes Bartscher gemalt worden, der eine große Werkstatt mit 20 Gesellen und Lehrlingen führte. Er kann zwar wegen der unterschiedlichen "Handschrift" die Bilder in Ascheberg nicht gemalt haben, hat aber wie die Maler in Herbern, Sassenberg und Liesborn nach einer seit etwa 1846 in Europa weit verbreiteten Vorlage gearbeitet, nämlich dem großen Kreuzweg in der Wiener Kirche St. Johann Nepomuk an der Praterstraße, den der Kunstprofessor Joseph Führich 1844 dort in Freskotechnik an die Wand gemalt hat. |
 |
|
Führich wählte mit Bildmaßen von 2,40 m Höhe und 1,85 m Breite ein ungewöhnlich großes Format. Er wollte damit den Betrachtern das Erlebnis vermitteln, beim Rundgang unmittelbar in das Geschehen auf dem Leidensweg Jesu einbezogen zu sein. Deshalb legte er die untere Bildkante auf den Flur der Kirche und stellte alle Personen lebensgroß dar. Dieses Format übernahmen die an Kopien interessierten Kirchengemeinden allerdings nicht, auch nicht die drängende Fülle von 170 Personen und 10 Pferden des Originals. Die Nach-Maler reduzierten die Gesamtmaße und die Anzahl der Menschen und Tiere - in Ascheberg blieben nur 119 Personen und keine Tiere -, änderten aber sonst so wenig wie möglich, mit Ausnahme der Farben, denn die Vorlagen wurden als schwarz-weiße Holz- und Stahlstiche verbreitet. Kaum ein Kopierer reiste nach Wien zum Original. In der Regel färbte man die Bilder nach eigenen Vorstellungen. Man fügte jedoch keine Figuren und Dinge hinzu und veränderte auch Gesten und Körperhaltung der Dargestellten nicht. So ist bei allen Kopien auf der dritten Station der gleiche Soldat mit der erhobenen Keule und neben ihm der gleiche Mann mit dem drohenden Zeigefinger und der auf die linke Hüfte gestützten Hand zu sehen. Für uns Münsterländer ist besonders interessant, dass Führich die 1843 unter dem Titel "Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus" erschienenen Visionen der Dülmener Klosterfrau Anna Katharina Emmerick kannte und sie seiner Arbeit zugrunde legte. So entspricht der auf der vierten Station die Kreuzigungsnägel vorzeigende junge Mann ihrer Schilderung. Sie nennt ihn einen "niederen Buben". In Herbern und Rorup fehlt dieser Mann allerdings. In Herbern ist an seiner Stelle ein bärtiger Mann zu sehen, der abwehrend seine linke Hand erhebt. Er entspricht dem Führichschen Original, fehlt aber in Ascheberg. Der Maler Joseph Führich wurde 1800 in Kratzau, Böhmen, geboren, studierte an der Prager Kunstakademie, schloss sich in Rom der Malergruppe der Nazarener an und erhielt 1840 den Lehrstuhl für Historienmalerei an der Kunstakademie in Wien. 1861 erhob Kaiser Franz Josef ihn in den Adelsstand, und als Joseph Ritter von Führich starb er vor einhundertundzwanzig Jahren, am 13. März 1876, am Montag nach dem 2.Fastensonntag, in Wien. Er war der geistige Vater des Kreuzwegs in unserer Kirche, auch wenn hier ein anderer Maler seine künstlerischen Ideen kopiert hat. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Heiligenbilder in Ascheberg
|
Wer durch Ascheberg geht, um nach religiösen Wegebildern zu suchen, wird schnell feststellen, dass es sehr viele Kreuze, aber nur wenige Bilder von Heiligen gibt. Das mag daran liegen, dass der gekreuzigte Jesus als das Heil der Welt verehrt und als Gott angebetet wird. Alle Heiligen sind neben ihm zweitrangig, wenn auch mancher frommer Katholik seine besondere Vorliebe für diese oder jene Persönlichkeit aus dem großen Kreis der "Freunde Gottes" durch das Aufstellen ihres Bildes, meistens einer Statue, zum Ausdruck bringt. Natürlich sieht man die größte Versammlung von Heiligenbildern an und in der Kirche. Einige wenige finden sich im Dorf und in den Bauerschaften. Am ehemaligen Haus des Direktors der Ascheberger Landwirtschaftsschule, Joseph Claes, das heute Baron von Twickel gehört, steht eine Statue des Antonius von Padua mit dem Jesuskind auf dem Arm. Sie erinnert an den Tod eines kleinen Jungen aus der Familie Heuckmann vom gegenüberliegenden Bauernhof. Ein weiterer Antonius von Padua steht seit 1980 am Davert-hauptweg. Er wurde 1874 von der Familie Rellmann aufgestellt. |
 |
|
Bei den Höfen BoIlermann in der Osterbauerschaft und Lohmann in der Nordbauer steht eine Herz-Jesu-Statue, Gegenüber dem Bild des Gekreuzigten ist das vom guten Herzen Jesu eigentlich freundlicher und doch viel seltener anzutreffen. Das könnte damit zusammenhängen, dass das Kreuz als das eigentliche christliche Zeichen des Heils gilt, und das traditionelle Herz-Jesu-Bild so viele Jahre nach der Einführung des Herz-Jesu-Festes im Jahre 1856 und seiner Einstufung als Hochfest 1928 noch immer keine Form gefunden hat, die die Beter überzeugt. Das auf die Kleidung Jesu aufgeheftete flammende Herz ist wohl kein wirklich ergreifendes Bild. Das bei Baumhöver, Schwienhorst, Heckenkamp und Schöpper in der Nordbauerschaft, bei Trahe, Schöler, Mertin-Puck und Holtschulte in der Osterbauer aufgestellte Bild "Maria mit dem Jesuskind" ist beliebter als jedes andere, Dazu kommt noch die Marienklage, auch Pietà und Vesperbild genannt, die bei den Höfen Westhues, Lendermann, in Greives Kapelle, bei Siesmann und Heuckmann und in der Kirche steht, alle als Kopien der Pietà von Wilhelm Achtermann aus dem Dom zu Münster, die im Hitlerkrieg zerstört wurde. Fast ausgestorben sind die Lourdes-Grotten, die nach den Marienerscheinungen vor der Bernadette Soubirous 1854 in Lourdes im 19. und frühen 20, Jahrhundert nach Art der Weihnachtskrippen gebaut wurden, oft aus dunklen Schlackensteinen, um den Charakter einer Grotte nachzubilden, man findet sie noch bei Sobbe und Rehr in der Nordbauerschaft . Nur ein Katharinenbild gibt es In Ascheberg, dem Ort der großen Katharinenprozession: bei Willermann in der Westerbauerschaft. Das in Schulze Heilings Hofkapelle wurde schon vor vielen Jahren gestohlen und die Kapelle ruiniert. Ein Lambertusbild ist in keiner Bauerschaft zu finden. Wegebilder, die in neuen Formen errichtet wurden, sieht man bei Feldmann-Gripshöver in der Westerbauer und bei Fallenberg in der Osterbauer. Beide Familien stellten ein Kreuz auf, ohne den Gekreuzigten, aber mit ungewohnten Zeichen, Bei Fallenberg ist das Kreuz mit symbolischen Pflanzen und Kugeln bedeckt und von beschrifteten Steinen umgeben, die Dankbarkeit, Glauben und Freude zum Ausdruck bringen. Bei Feld-mann-Gripshöver trägt das geome-trisch exakt gearbeitete Kreuz im Schnittpunkt eine runde Öffnung mit einem kleinen Herzen darin. Am Fuß des Kreuzes steht ein Text, der an die Zerstörung des World Trade Centers im Jahre 2001 in New York erinnert. Beide Familien beschritten damit neue Wege In der Gestaltung von christlichen Wegebildern. Die größte Gruppe unter ihnen bilden Kreuze, die meisten sehr groß, mit Gebeten auf dem Sockel und zum Teil mit Dornenkrone, Geißel, Hammer, Nägel, Stricken, Lanze und Essigschwamm, die als Arma Christi (Waffen Christi) bezeichnet werden, unter den Füssen des Gekreuzigten. Am Hause Drees auf der Sandstrasse steht die Skulptur des in der Todesangst leidenden Jesus am Ölberg. Es stand ursprünglich an der Biete gegenüber dem Krankenhaus und hat vielleicht manchen Schwerkranken Trost gegeben. Am 1910 eingeweihten Kirchturm stehen außen zwölf Heiligenbilder: über dem Turmportal der Kirchenpatron Lambertus, einige Meter über ihm die zweite Patronin Katharina von Alexandrien, an der Nordseite der ehemaligen Taufkapelle Maria mit dem Jesuskind und Josef, der Pflegevater. Weniger gut sichtbar stehen in großer Höhe unter der Balustrade acht heilige, vier Frauen und vier Männer. Es sind an der Westseite St. Ludger und St. Gottfried von Cappenberg und IIbenstadt, an der Südseite St, Ida und St. Elisabeth, an der Ostseite St. Bonifatius und St. Hubertus, an der Nordseite St. Anna und St, Mathilde. Bonifatius hieß eigentlich Winfried, den lateinischen Bischofsnamen gab ihm der Papst. St. Anna ist eine biblische Persönlichkeit, Mutter Marias und Großmutter Jesu. Vor der Lambertuskirche steht eine Kreuzigungsgruppe, die neben dem Kreuz die Mutter Maria und Johannes den Evangelisten zeigt, der sehr selten allein dargestellt wird, auch hier nicht. Johannes dem Täufer wird in der Bibel ein wesentlich eindrucksvolleres Auftreten geboten, wenn er Jesus als das Lamm Gottes vorstellt. Aber diese Szene gehört nicht zu den klassischen Wegebildern. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Ostseite des Kirchplatzes
 |
|
Die östliche Seite des Ascheberger Lambertus-Kirchplatzes hat sich im vergangenen Jahrhundert so sehr verändert, dass selbst die Ortskundigen stutzen, wenn sie eine Abbildung davon sehen. Da kein Foto davon zu finden war, wurde nach mehreren Einzelbildern die hier abgebildete Zeichnung angefertigt. Von den zwei großen Gebäuden rechts und links wird man das rechte schnell als den älteren Teil der ehemaligen Gaststätte Burghof (heute OJA) erkennen. Das linke dagegen steht seit 1964 nicht mehr und wird wohl nur von älteren Mitbürgern oder gut informierten jüngeren erkannt werden. Es ist die „Jungenschule“, eines der drei Gebäude der damaligen Volksschule. Es wurde 1873/74 als Mädchenschule errichtet und um 1910 den Jungen gegeben, als für die Mädchen die Schule an der Himmelstraße gebaut worden war. Bevor die Realschule 1963 ihren Neubau am Bahnhofsweg bezog, war sie einige Jahre in diesem Haus untergebracht. Das niedrige Gebäude daneben enthielt die Schultoiletten. Im Keller der Schule gab es Räume für Holz und Kartoffeln, die an einige Nachbarn vermietet waren. Von den zwei übrigen Häusern ist den Aschebergern das linke bekannt. Es ist das bei der Ortskernsanierung 1967 abgebrochene kleine Mietshaus, das der Einfachheit halber nach seinem letzten Mieter als „Haus Riedel“ bezeichnet wird. Es gehörte der Familie Forsthoff. Das kleine Fachwerkhaus dahinter ist wegen seiner Bewohner bemerkenswert. Es wurde schon in den 1930er Jahren abgebrochen. Da auf einer Fotografie dieses Hauses in der halboffenen Tennentür eine Frau zu sehen ist, wurde sie auch auf der Zeichnung wiedergegeben. Es ist Frau Juliane (oder Julia) Siebeneck, die dort nach dem Tode ihres Mannes Hermann allein lebte und 1931 starb. Hermann Siebeneck war Kunstschreiner gewesen. Seine Werkstatt hinter dem Haus bewahrte noch lange die vielen Handwerkszeuge auf, die er für seine künstlerischen Schnitzereien benötigt hatte. Von ihm stammen die neugotischen mit komplizierten Schnitzwerken ausgestatteten Beichtstühle in unserer Kirche, aber auch die Kanzel und das Chorgestühl, das sich seit einigen Jahren in St. Margaretha in Ostenfelde befindet. Erst in den 1960er Jahren brach die Familie Forsthoff ihre landwirtschaftlichen Gebäude und auch Siebenecks Werkstatt ab. Juliane Siebeneck war eine geborene Forsthoff und verwitwete Braumann. In zweiter Ehe heiratete sie 1889 den um 24 Jahre älteren Hermann Siebeneck, der ebenfalls Witwer war und 1915 starb. Die Familie Forsthoff wurde früher urkundlich oft auch Forsthove, manchmal „Forsthove sive Forsthoff“ (sive = oder), genannt. Es sind wohl beide Formen üblich gewesen. Bevor im Jahre 1835 der Bäcker Heinrich Forsthoff aus Glandorf sich hier einheiratete, hieß die Familie jedoch Schlüter. Ob der erste Träger dieses Namens (Schlüter = Schließer) im Mittelalter das Tor der legendären Burg Ascheberg oder „nur“ des Borg-Speichers der Kirchengemeinde zu schließen hatte, bleibt weiterhin ungeklärt. Juliane wurde immer „Jule“ genannt. Alte Leute erinnern sich, dass sie leicht reizbar und beim Schimpfen mit Schulkindern, die sie oft und gern ärgerten, nicht zimperlich war. Die Große-Jungen-Schule nebenan bot ihr reichlich Gelegenheit dazu. Der vor einigen Jahren errichtete Erweiterungsbau der damaligen Gaststätte Forsthoff, in dem sich heute das „Restaurant Burghof“ befindet, steht auf dem Platz der beiden alten Häuser. Von der ehemaligen Schule ist nichts geblieben außer einem Stück der Schulplatzmauer, die vom Biergarten des Restaurants aus gut zu sehen ist. Die Zeichnung gibt im Wesentlichen den Zustand um etwa 1910 wieder. Das große Feuer von 1903 hatte einige Häuser, die zwischen den hier abgebildeten und dem Chor der Kirche standen, darunter auch das alte Haus Forsthoff, zerstört. Auch das Haus des Maurers Schwipp, das etwa am Ende des heutigen Pfarrheims stand, brannte damals ab. Die Familie Schwipp errichtete einen Neubau an der Dieningstrasse. Er gleicht in Größe und Baustil dem Forsthoffschen. Übrigens umgab die kleine Mauer vor Siebenecks Haus keineswegs einen idyllischen Sitzplatz oder einen Biergarten, sondern den Mistfall, der zusammen mit der Jauchegrube den wichtigen Dünger für Garten und Acker lieferte. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die evangelische Gnadenkirche
|
Am 17. Dezember 1950, dem dritten Adventssonntag, erhielten die evangelischen Christen ein eigenes Gotteshaus am Hoveloh. Damit ging nach vielen Jahren die Zeit der wandernden Gottesdienste in Gasthaussälen, Schulräumen und dem katholischen Vereinshaus (heute Pfarrheim) zu Ende. Wer sich über die Entstehung und Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ascheberg informieren will, findet reiches Material in der 1990 vom damaligen Pfarrer Jürgen Diener verfassten Festschrift zum vierzigjährigen Kirchweihjubiläum. |
 |
|
Ascheberg war bis zum Beginn der Evakuierten- und Vertriebenenströme aus den Großstädten und aus Ostdeutschland eine rein katholische Gemeinde. In den Jahren 1945 und später kamen Menschen, die nie den Wunsch gehabt hatten, sich in Westfalen, im Münsterland, in Ascheberg niederzulassen, Sie waren von der "Brandungswelle des Elends“ - so nannte der Lüdinghausener ev. Pfarrer Gerhard Barten diesen Zuzug ~ hierher geschwemmt worden, unter ihnen viele evangelische Christen, denen zunächst so gut wie jede geistliche Orientierung fehlte. Die katholischen Heimatvertriebenen fanden sich etwas leichter - keineswegs leicht - zurecht. Sie konnten sonntags und werktags in Kirchen gehen, die denen zu Hause gleich waren. Der Pfarrer sprach oder sang sein Latein, die Messdiener klingelten, die Lieder waren weitgehend aus der Heimat bekannt, und auch der Weihrauch roch wie "darheeme“. Die Bilder der Heiligen, besonders der Muttergottes mit dem Jesuskind, standen auch hier, bereit zu helfen und zu trösten, wenn man sie darum bat .Und das tat man mit Inbrunst und In der Hoffnung, dass die Rückkehr in die Heimat nicht all zu lange auf sich warten ließe. Einige evangelische Christen besuchten hin und wieder auch die katholische Kirche, nicht sehr glücklich über einen solchen Seitensprung, aber überzeugt, dass hier der gleiche Gott wie in der Kirche der Heimat ihre Gebete hören würde. Sie beteten besonders gern das Vaterunser, das die Katholiken ja im gleichen Wortlaut sprachen. Dass das Miteinander von katholischen und evangelischen Christen in dieser schweren Zeit keine Liebesgeschichte sein konnte, war jedem klar, der nur ein wenig von der Kirchengeschichte seit der Reformation wusste. Man musste sich auf beiden Seiten überwinden, aber die Katholiken hielten den längeren Hebel. Ihre Familien waren alteingesessen, man kannte sich seit Jahrzehnten. Die Evangelischen waren eine ortsfremde Menge von Menschen, die keine gemeinsame Heimat hatten, die sich erst nach und nach näher kennen lernten. Das allein war schon schwer genug. Ihre Dialekte waren sehr unterschiedlich und ähnelten nicht im mindesten dem münsterländischen Platt, das hier überall zu hören war. Aber eines Tages verstanden auch die Ostpreußen, was die alte schlesische Bäuerin meinte, wenn sie, wie immer und trotz kalten Winterwetters viel zu früh zum Gottesdienst erschien und in der Kirche leicht missbilligend feststellte: "No gar ni worm inne" (Noch gar nicht warm hier drinnen). Im Jahre 1950 konnte in Ascheberg die erste evangelische Kirche im Hoveloh eingeweiht werden. Es war eine sog. Bartningsche Notkirche, die nach dem Architekten Otto Bartning (1883 -1959) benannt war. Die Gemeinde nutzte sie als Gotteshaus und als Gemeindehaus für Presbyteriumssitzungen und Treffen aller Art. Sie wurde der Mittelpunkt des kirchlichen Lebens, von allen begrüßt und von allen als nicht im mindesten vergleichbar mit der geliebten Kirche in der Heimat angesehen, Aber bald würde man ja wieder nach Hause zurückkehren können. So lange müsse die Bartning-Kirche als Ersatz dienen. In den vergangenen 55 Jahren ist sie aber eine echte Pfarrkirche geworden, nicht prächtig und nicht mächtig, aber ein geistliches Haus, das seine Gründer Gnadenkirche nannten, weil sie ihr Leben und Überleben als Gnade empfanden und weil für sie nun wieder eine Kirche im Dorf war. Die Bartning-Kirche in Ascheberg ist die einzige ihrer Art in Deutschland, die unverändert den Originalzustand zeigt. Sie steht unter Denkmalschutz, und manchmal staunen fremde Besucher, dass es sie überhaupt noch gibt. Inzwischen hat sich vieles geändert. Die alten Heimatvertriebenen sind verstorben. Ihre Enkelkinder kamen hier zur Welt, wurden in der Gnadenkirche getauft und konfirmiert, manche auch getraut, und die Heimat ihrer Großeltern ist ihnen so fremd wie diesen einst Ascheberg. „Meine Oma stammt aus Schlesien-Holstein". Auch das hört man zuweilen von Kindern, Es geschieht, wie überall, auch allerlei Ökumenisches. Vor Jahren legte der katholische Pfarrer nach Art der Apostel einer jungen Pfarrerin bei ihrer Ordination die Hände auf. Der Bischof von Münster war Gast des evangelischen Pfarrers. Trauungen von evangelisch-katholischen Brautleuten sind keine Seltenheit mehr. Die kleine Bartning-Kirche am Hoveloh ist schon längst eine Ascheberger Kirche geworden. (siehe dazu auch in der Geschichte im Teil 4) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Quer durch die Davert
|
Die Davert mit ihren guten Wegen und Parkplätzen gilt heute, sogar in den rauhen Jahreszeiten, als Naherholungsgebiet. Das war früher nicht der Fall. Im Gegenteil: wer sie nicht unbedingt durchqueren musste, machte wegen ihrer Sümpfe und unpassierbaren Wege einen großen Bogen um sie. Das änderte sich erst, als nach der Neuordnung der Davert (Rezess von 1841) und die Gründung der Davertgenossenschaft durch Ausbau der Gräben und Wege das Gebiet urbar gemacht wurde. Es gab sogar für rund 130 Jahre einen Davertkommissar, der die Arbeiten an Wegen und Gräben koordinierte und beaufsichtigte. Das war bis 1969, als die Davertgenossenschaft aufgelöst wurde, der Ascheberger Amtmann (Gemeindedirektor). Als 1848 die Eisenbahnstrecke Münster-Hamm eröffnet war, wurde der Rinkeroder Bahnhof für viele Ascheberger und Davensberger, die den Fußweg durch die Davert nicht scheuten, eine wichtige Einrichtung. Auch Wald- und Holzarbeiter transportierten Baumstämme nach Rinkerode, wo sie von einem großen Holzplatz am Bahnhof als Grubenholz verladen und zu den Zechen geschickt wurden. Das alles ohne Motorkraft, nur mit Pferden, die Stamm für Stamm über den Platz zogen. Einmal im Jahr, nämlich am Sonntag nach dem Jacobitag (25.Juli), kamen und kommen viele Rinkeroder zur Ascheberger Katharinenprozession und zum anschließenden Jahrmarkt (heute Kirmes). Ascheberger Kiepenkerle - besser gesagt: wandernde und fahrende Geschäftsleute - waren in Rinkerode bestens bekannt und wurden regelmäßig erwartet. Heute hat der Raiffeisenmarkt, der von Rinkerodern und Aschebergern gemeinsam betrieben wird, eine neue Verbindung quer durch die Davert geschaffen. Auch die Davertparkplätze werden zu Treffpunkten. So der an der Hohen Heide, wo sich die Heimatvereine von Rinkerode, Davensberg, Ascheberg und Amelsbüren im Sommer 99 trafen, als die Rinkeroder nichtamtliche, aber dekorative Grenzsteine gesetzt hatten. Aber auch weit entfernt von wirtschaftlichen Interessen förderte die Davert „überörtlich“ das, was man früher „zarte Bande“, heute „Beziehungen“ nennt. „Wat häff wi en Glück inne Spriäkeldöärn“, dichtete der Ascheberger Dr. Gustav Merten vor 50 Jahren. Die Spriäkeldöärn sind ein Waldstück in der Rinkeroder Davert. Das ungewöhnlichste Fahrzeug auf dem Weg quer durch die Davert war von 1917 bis 1925 der „Pängelanton“, eine Kleinbahn, die Material für den Bau der Eisenbahn Münster-Dortmund von Rinkerode nach Ascheberg transportierte. Um auch Personen befördern zu dürfen, erhob der preußische Innenminister sie auf Antrag ihrer Betreiberin, der Fa. Philipp Holzmann in Frankfurt am Main, in den Rang einer Kleinbahn, denn eigentlich war sie nur eine Feldbahn, schmutzig und klapprig wie alle dieser Art. Bis in die 50er Jahre stand in der Weide (heute Wohngebiet) zwischen dem Göttendorfer Weg und der Fa. Staljan ein vergessener Prellbock dieses Bähnchens. Ende August 1650 suchten die Schweden das Dorf Ascheberg und die Osterbauerschaft heim und hausten dort brutal, wie üblich. Für ihren Abzug verlangten sie 100 Reichstaler. Aber nur 60 konnte man zusammenbringen. Deshalb schickte der Pfarrer am 31.August 1650 einen reitenden Boten gegen Mitternacht nach Rinkerode zum Haus Bisping, um Heinrich von Galen um 40 Taler, leihweise natürlich, zu bitten. Der Bote ritt mit dem Geld und in tausend Ängsten zum Pastor zurück, die Schweden nahmen es und verließen tags darauf Ascheberg. Vielleicht hatte Heinrich von Galens fromme Mutter Katharina von Hörde bei ihrem Sohn ein gutes Wort für die geplagten Leute jenseits der Davert eingelegt. Das Geld wurde, wenn auch nach allerlei Zankereien, von den Aschebergern zurückgezahlt. Als die Rinkeroder in den Jahren 1721 bis 24 von Pictorius die Pfarrkirche St. Pankratius erbauen ließen, besichtigten auch viele Ascheberger die Baustelle und erst recht die fertige Kirche. So etwas Prächtiges hatte man selten gesehen, und es regte sich der Wunsch, auch an der Ascheberger Kirche ein neues Chor mit einem großen Hochaltar wie in Rinkerode zu bauen. So geschah es zwischen 1737 und 1740. Und wenn die Rinkeroder sich Gottfried Laurenz Pictorius leisten konnten, dann die Ascheberger Johann Conrad Schlaun. Bezahlt haben allerdings der Patronatsherr Ferdinand von Plettenberg-Nordkirchen und nach dessen frühem Tod seine Frau Felicitas von Westerholt-Lembeck. In Rinkerode ging es aber auch nicht ohne das Geld und die Beziehungen des Jobst von Kerckerinck zur Borg. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der kniende Jesus am Ölberg an der Sandstraße
|
Man erfährt im Allgemeinen selten, aus welchem Anlass sich eine Familie entschließt, einen Bildstock oder ein Wegekreuz aufzustellen. Nur ausnahmsweise gibt eine Inschrift auf der Rückseite mehr an als die Namen der Stifter und das Jahr des Entstehens. Das gilt besonders bei Bildwerken, die Gefühle des Schmerzes und der Trauer auslösen können wie die Bilder des leidenden Jesus am Kreuz, an der Geißelsäule oder in der Todesangst am Ölberg. Das Jesusbild der Familie Drees an der Sandstraße in Ascheberg gehört zu dieser Gruppe. Es wird erzählt, dass die Landwirte Drees, Witthoff-Klute und Schräder auf Haus Romberg um die Mitte des 19.Jh. gelobten, ein Kreuz oder ein Heiligenbild aufzustellen, falls sie im Prozess der Bauernbefreiung eines Tages tatsächlich eigener Herr auf ihrem Grund und Boden sein würden. Anscheinend misstrauten sie dem für sie wohl nicht restlos durchschaubaren Verfahren der Ablösung ihrer aus der Leibeigenschaft herrührenden Verpflichtungen und der komplizierten Finanzierung. Als sich der erhoffte Erfolg einstellte, stiftete Drees das Bild des (am Ölberg) knienden Jesus. Wann das war, ist nicht bekannt.Es könnte um 1890 nach der Gründung des St.-Lambertus-Hospitals (1888) gewesen sein, denn es wurde in Drees' Garten gegenüber dem Eingang des Krankenhauses aufgestellt, und es ist anzunehmen, dass diese Stelle in einer bestimmten Absicht gewählt wurde. |
 |
|
Waren bislang die Kranken in ihren Wohnungen versorgt worden, so gut es ging, so stand nun ein von Fachleuten geleitetes Krankenhaus zur Verfügung, das manche Krankheit linderte oder heilte, das aber auch, anders als bisher, die Leidenden und auch die Sterbenden unter einem Dach versammelte. Für den täglichen Gottesdienst und das persönliche Gebet war eine Hauskapelle eingerichtet worden. Aber wenn die Patienten durchs Fenster ins Dorf hinein schauten und die gewohnte Arbeit zu Hause herbeisehnten, fiel ihr Blick auf das Bild des in der Angst vor dem Sterben zusammengesunkenen Jesus. Das mag manche getröstet und zu geduldigem Ertragen geführt, andere vielleicht auch erschreckt haben. Einige waren Mitglied der Bruderschaft vom Guten Tod (volkstümlich Todesangst-bruderschaft genannt) und daher mit diesem Bild besonders vertraut. Es ist anzunehmen, dass auch die Urgroßeltern Drees dazu gehörten. Vielleicht haben der Pfarrer und die Franziskanerinnen im Krankenhaus damals bei der Entscheidung geholfen. Es gibt nicht sehr viele solcher Ölbergbilder. Das nächste steht am Hof Hölscher in der Ottmarsbocholter Oberbauerschaft, nicht weit von der Gaststätte "Hohe Lucht". Die Familie Schulze Becking hat es 1917 aufgestellt. Sie und der Bildhauer haben dabei ein Problem erkannt, mit dem sich schon die Christen der Frühzeit befasst haben, mit der Frage nämlich, ob der als Gott verehrte Jesus in der Todesangst dargestellt werden sollte. Die ersten Christen haben es nicht getan. Erst im 15. Jh. wurden solche Darstellungen üblich. Beckings Christus kniet vor einem ihn stützenden und schützenden Felsenstück, auf das er die Unterarme mit den gefalteten Händen legt. Es ist immer noch eine Haltung der Souveränität, wenn auch einer sehr beschränkten, die den Eindruck der Todesangst etwas schwächt. Solche Zeichen des Schutzes haben der Bildhauer (Heinrich Plässer?) und die Stifter dem Jesus an der Sandstraße nicht gewährt. Seine Angst und Hilflosigkeit werden durch nichts gemildert. Hier wie auch bei dem Beckingschen Bild fehlt auch der tröstende Engel, der das Bild des Leidens mit Hoffnung verbindet. Allerdings erwähnt ihn nur der Evangelist Lukas (22,43). Im münsterschen Dom wurde 1712 ein künstlerisch bedeutendes Bild der Ölbergszene aufgestellt: das Grabdenkmal des Dompropstes Ferdinand von Plettenberg. Es zeigt zwei Engel, die Jesus beistehen, der eine stärkt ihn seelisch, der andere stützt seinen zusammenbrechenden Körper. Auch in dem Ölbergbild am Hof Brünemann in Herbern steht ein Engel Jesus zur Seite, nicht in respektvoller Distanz, sondern körperlich nahe und mit Gesten der Zuneigung. Dagegen wirkt das Bild bei Drees realistischer und deshalb härter, unabhängig von der künstlerischen Gestaltung und den Spuren des Alters. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Bahndamm der Eisenbahn Münster-Dortmund
|
Galgenheide, Lövelingloe, Amelsbüren und Sudhof , alles tief gelegene Gebiete südlich von Münster, zwangen die Erbauer der Eisenbahnstrecke Münster - Dortmund einen mehrere Meter hohen Damm für die Gleise aufzuschütten. Den dazu nötigen Sand holte man von der Geist nördlich und aus der Hohen Ward südlich von Hiltrup. Damals entstanden die noch lange nach dem Hitlerkrieg sichtbaren und nutzbaren tiefen Sandkuhlen an der Hammerstraße nahe der Gaststätte Vennemann und der Steiner See, der heute Hiltruper See genannt wird, zwischen dem Emmerbach und der Hohen Ward. Eine Feldbahn mit einer Lokomotive, die "Pängelanton" hieß wegen ihres blechern klingenden Läutewerks, transportierte Sand und Kies aus dem Gebiet zwischen Emmerbach, Hammerstraße und der Hohen Ward. Ihre Strecke bis zum Bahndamm bei Amelsbüren betrug etwa fünfeinhalb bis sechs Kilometer und führte parallel zur Emmer in Richtung der Höfe Haus Köbbing, Schulze Harling und Schulze Everding zum geplanten Bahnhof Amelsbüren. Die seit 1848 bestehende Bahnstrecke Münster - Hamm hatte ursprünglich am Steiner See einen Bahnhof für Hiltrup und Amelsbüren, der aber nach Fertigstellung der Dortmunder Strecke weiter nördlich an seinen heutigen Platz an der Wolbecker Straße verlegt wurde, die um 1900 noch streckenweise ein Sandweg war. |
|
Die Einwohner Amelsbürens gingen um 1900 entweder zu Fuß über Lövelinkloe und den Kappenberger Damm nach Münster oder seit 1848 zum Bahnhof Hiltrup, wo sie in den Personenzügen eine 1., eine 2. und eine 3.Klasse wählen konnten für die Fahrt nach Münster oder über Rinkerode, Drensteinfurt, Mersch und Ermlinghof (heute Bockum-Hövel) nach Hamm. Der Weg von Amelsbüren zum Bahnhof Hiltrup betrug rund sechs Kilometer. Natürlich wünschte man sich in Amelsbüren einen eigenen Bahnhof im Ort, aber der Weg zum Hiltruper Bahnhof war durchaus noch erträglich. Trotzdem jubelte man am 17. Oktober 1928, einem Mittwoch, aufs höchste, als der erste Zug im endlich "eisenbahnbeglückten Amelsbüren", anhielt, wie eine lokale Dichterin schrieb. |
 Einweihung Bahnhof am 17.10.1928 |
|
Es gab keine störenden Schranken an den Wegen, sondern nur Unterführungen, alle viel bequemer als die beschrankten Übergänge an der Hiltruper Stecke, wo in sehr einfachen Wärterhäuschen sparsam besoldete Schranken-wärter in drei täglichen Schichten auch die eiligsten Pferdewagen zum Halten zwangen. Allerdings boten sie den Wartenden einen Einblick in die Eisenbahn-technik, das Öffnen und Schließen der Schranken, die Bedeutung der Läutesignale, der an Stahlmasten montierten Signalzeichen und die vorgeschriebene Überwachung der vorbeifegenden Züge durch die Schranken-wärter. Das alles konnte man aus den hoch auf dem Damm fahrenden Zügen nicht sehen und sich auch kein Bild machen von schrecklichen Unglücksfällen, wenn ein Schrankenwärter die Schranken nicht ordentlich schloss. Was soll`s - in Amelsbüren, Davensberg, Ascheberg, Capelle und Werne war man glücklich über die neue Bahn. An jedem Bahnhof gab es ein Festessen oder wenigstens einen üppigen Imbiss. Der Heimatverein Amelsbüren hat die Menukarten aufbewahrt und kann über die Speisung der ausgewählten Gäste Auskunft geben. Zylinderbewehrte Herren hielten Ansprachen, und örtliche Gesangvereine schmetterten ihre Lust in die kühle Oktoberluft. Überall gab es Bahnhofsgaststätten, wo die oft reichlich früh angekommenen Fahrgäste vor der Abfahrt ihres Zuges noch ein Glas zu sich nehmen konnten. In Ascheberg hatte man auch riesige Mengen von Kies und Sand herbeischaffen müssen, auch aus der selben Quelle am Hiltruper See, aber viel umständlicher. Alles wurde nach Rinkerode gebracht, am Bahnhof ausgeladen und auf die Loren einer Feldbahn geladen, die quer durch die südliche Davert nach Davensberg und Ascheberg fuhr. Hier war die Strecke aber fast doppelt so lang wie in Hiltrup-Amelsbüren, knapp 12 Kilometer und viel komplizierter eingerichtet. Ab 1915 lief der Transport des Baumaterials, ab 1917 auch den Personenverkehr in zwei Waggons. Dazu erhob die Königliche Regierung die Feldbahn in den Rang einer Kleinbahn. Trotz des Weltkriegs konnte man weiter arbeiten, die Davertbahn ermöglichte es vielen Hunger leidenden Großstädtern, die Bauernhöfe in ihrer Nähe aufzusuchen, um nach Lebensmitteln zu fragen oder sie gegen Sachgüter einzutauschen. |
| Die Davertbahn hatte ihren Ausgangspunkt am Bahnhof Rinkerode, etwa am heutigen Molkereiweg, fuhr dann parallel zum heutigen Göttendorfer Weg nach Süden an der Reichsbahnstrecke entlang bis zum heutigen Haus Honerpeick, das damals eine Eisenbahnerdienstwohnung war, überquerte den Göttendorfer Weg und folgte ihm dann ein kurzes Stück an der westlichen Seite bis zum heutigen Haus Wickensack, bog dort nach Westen ab und überquerte die Felder und die Eickenbecker Straße und erreichte am heutigen Mühlenmuseum die Hammer Straße (B 54), überquerte auch diese und folgte im wesentlichen dem Schlagenweg bis zum heutigen Daverthauptweg. | 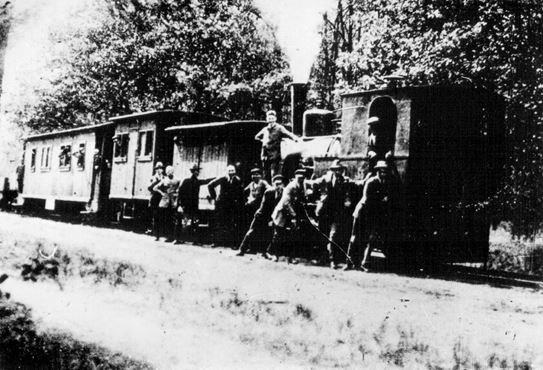 |
|
Zwischen den Höfen Lohmann und Schlüter verließ sie den Schlagenweg und verlief geradeaus hinter der Scheune des Hofes Ashege wieder zum Schlagenweg kurz vor der Zufahrt zum Hof Daverthüser-Bäumer. Die Bahn folgte also nicht dem großen Bogen des Weges bei den Höfen Brencke und Stückmann an der Flaggenbachbrücke. Italienische Arbeiter der Fa. Philipp Holzmann, Frankfurt am Main, hatten hinter Ashege über den Flaggenbach eine Holzbrücke gebaut, deren Reste noch einige Jahrzehnte am Bachufer zu sehen waren. Nun ging es weiter über den Daverthauptweg hinaus durch den Wald zum Hofkreuz Pellengahr am Rinkeroder Weg und über diesen und den Davensberger Telgenpatt zum Bahndamm, wo je nach dem Stand der Bauarbeiten die Wagen entleert wurden. Die Fahrgäste wurden bis zum geplanten Bahnhof in Ascheberg gebracht. Für sie gab es einen Fahrplan, so dass die Davertbahn tatsächlich als ordentlicher Personenzug gelten konnte. Der Ascheberger Schulrektor Anton Otte dichtete damals ein bei vielen Gelegenheiten viel gesungenes Lied mit dem Kehrvers: "Was wären wir übel dran, gäb es nicht die Pängelbahn". Sie wurde viel benutzt, hatte einen eigenen Schaffner, der Fahrkarten verkaufte und den guten Geist des Davertverkehrs spielte. Völlig unfassbar war daher für alle Ascheberger und Rinkeroder, dass einer der Schaffner eines Tages von einem jungen Mitfahrer ohne ersichtlichen Grund erschossen wurde, nachdem dieser nach der Höhe der Fahrkarteneinnahme gefragt hatte. Es scheint sich um einen psychisch gestörten Jungen gehandelt zu haben, dem niemand so eine Tat zugetraut hatte. Er war anscheinend bekannt. Obwohl jeder wusste, dass die Davertbahn nur ein Provisorium war, und der Bahnhof Rinkerode nicht mehr interessant sein würde, wenn die Dortmunder Strecke fertig war, war der Schrecken groß, als Philipp Holzmann schon 1925 den Betrieb einstellte, weil die Materialtransporte nicht mehr erforderlich waren. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Katharinenprozession
|
Wenn alljährlich die Ascheberger Kirmes näher rückt, muss sich unsere Aufmerksamkeit auf eine große steinerne Heiligenfigur richten, die seit mehr als 90 Jahren ziemlich einsam über dem Turmportal der Lambertus-Kirche steht. Es ist die Figur der hl. Katharina von Alexandrien, der zweiten Ascheberger Kirchenpatronin. Ihr verdanken wir die große Ascheberger Kirmes, eine der größten weit und breit. Trotzdem wird die Figur hoch oben an der Wand nur wenig beachtet, und viele Leute wissen heute gar nicht, welche Bedeutung Katharina einmal in und für Ascheberg hatte. Sie gehört zu der Heiligengruppe der „Vierzehn Nothelfer“, und nicht zuletzt diese Eigenschaft hatte es den Aschebergern angetan, obwohl die im Alter von 18 Jahren wegen ihres Glaubens hingerichtete Heilige immer ein verehrungswürdiges Vorbild war. Die große Nothelferin wurde in Ascheberg durch eine riesige Prozession geehrt, die am Sonntag nach Jacobi (25. Juli) - und nicht etwa am Katharinentag, dem 25. November, - stattfand. Sie begann am Samstagabend, ging die ganze Nacht hindurch weiter, und führte Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, auch aus Nachbarorten, an den Gemeindegrenzen Aschebergs entlang. An vier Stellen – den Himmelsrichtungen entsprechend – hielt man Gottesdienst, und zwar an Willermanns Baum, auf Stummanns Heide (Ottmarsbocholter Grenze), vor der Burg Davensberg und schließlich am Schönefeldsbaum, etwa 500 m nördlich der Gastwirtschaft „Schwatten Holtkamp“, wo die alte Rinkeroder Landwehr durch die B 54 unterbrochen wird. |
 |
|
Gewiss, man hielt Gottesdienst und nahm auch die Figur der Hl. Katharina mit, aber eine religiöse Feier war diese Riesenprozession nicht, und Pfarrer Wennemar Uhrwercker nannte sie „ärgerlich und abergläubisch“. Im Jahre 1649 beobachtete er voller Widerwillen, dass Prozessionsteilnehmer angetrunken, und unter wüsten Redensarten sogar Vieh mitnahmen, um es vor Unfruchtbarkeit zu bewahren. Er bekämpfte die Auswüchse dieser „Katharinen-Jacht“ und erreichte schließlich im Jahre 1653 eine wesentliche Verkürzung und Verbesserung der Prozession, was auch der Anordnung des Bischofs und Landesherrn Christoph Bernhard von Galen entsprach. Eines aber blieb: das mit der Prozession verbundene Volksfest. Wo viele Menschen zusammenkommen, gibt es Vergnügen, da macht man Geschäfte, da sitzt das Geld auch etwas locker. So entstand die Kirmes. Man nannte sie allerdings Jakobi-Kirmes, nicht Katharinen-Kirmes, was eigentlich richtiger gewesen wäre. Vielleicht wollte der Pastor den hl. Jakobus, einen Verwandten Jesu, lieber als Schutzpatron der Kirche haben. Die Katharinenprozession aber ging, wesentlich gesitteter, weiter. Im Jahre 1829 drohte ihr eine neue Gefahr, nicht vom Pastor, sondern vom Bischof von Münster Caspar Max von Droste Vischering. Er ordnete am 22. Dezember 1829 an, dass im Bistum Münster nur noch zwei Prozessionen zu halten seien: die Fronleichnamsprozession zehn Tage nach Pfingsten und eine zweite Prozession zehn Tage nach Fronleichnam. (Als große und kleine Prozession sind sie den älteren unter uns noch gut bekannt). Alle übrigen Prozessionen wurden untersagt. Da war Ascheberg in Not. Pfarrer Perick bat den Bischof um eine Sondererlaubnis für die Katharinenprozession am Sonntag nach Jakobi. Generalvikar Melchers erteilte am 15. Juni 1830 die Sondererlaubnis. Anstelle der zweiten Prozession dürfe die Katharinenprozession stattfinden, aber nur, wenn kein Vieh am Vorabend über den Prozessionsweg geführt wird und keine Tanzveranstaltungen stattfinden. „Ihrer Pfarrgemeinde haben Sie dieses von der Kanzel bekannt zu machen“. Leider haben die Ascheberger damals die Strenge ihres Bischofs unterschätzt. Die Katharinenprozssion 1830 schien ohne Tanzvergnügen am Abend nicht vollständig zu sein. Der zuständige Dechant musste dem Bischof berichten, was geschehen war. Den Brief an Pfarrer Perick vom 10. Mai 1831 unterschrieb Bischof Caspar Max persönlich. Er verbot die Katharinenprozession und verlangte auch in Ascheberg die zweite Prozession am zehnten Tage nach Fronleichnam. Von der Kirmes aber sprach er nicht, und so besteht sie heute noch. Der Gemeinderat hat eine Straße nach Pfarrer Uhrwercker benannt und damit einen Mann geehrt, der in schwerer Zeit ein großer Helfer und Tröster war, dazu ein Förderer der allgemeinen und religiösen Bildung nach dem Dreißigjährigen Krieg. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Ascheberger Türme und Türmchen
|
Der Kirchturm von St. Lambertus in Ascheberg ist mit 76 Metern Höhe einer der größten im Münsterland. Man sieht ihn von der Eisenbahn und von der Autobahn aus so gut, dass viele Zug- und Auto-Reisende bei seinem Anblick wissen, dass sie bald in Münster sein werden oder umgekehrt sich noch nicht weit davon entfernt haben. Aber natürlich war es nicht die Absicht der geistigen Väter des Lambertus-Turmes, Pfarrer Josef Degener und Architekt Ludwig Becker, einen riesigen Wegweiser nach Münster zu bauen. Pfarrer Degener hatte Bismarcks Kulturkampf gegen die katholische Kirche am eigenen Leibe erlitten – er durfte im Bistum Münster nicht als Priester arbeiten – und erlebte das Ende des Kulturkampfes als einen glorreichen Sieg der Kirche über die von Berlin ausgehende Macht des Bösen. Zwar war der kleine alte Kirchturm baufällig geworden, aber ein Neubau mit diesen Maßen war nicht erforderlich. Der Turm musste ein Jubelruf werden, ein stolzes Werk des katholischen Geistes. Ein viel bewundertes Geläut und ein Dutzend Gestalten großer heiliger Frauen und Männer sollten durch die kommenden Jahrhunderte verkünden, was Gott der Welt zu sagen hat. |
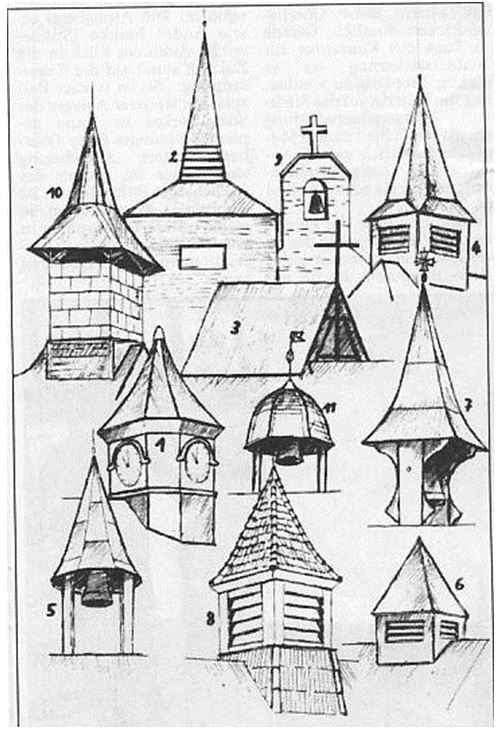 |
|
Es gibt aber noch eine Reihe kleiner Türme in Ascheberg, die jeder kennt, aber kaum jemand beachtet. Es sind alles Glockentürme, besser Glocken-türmchen, ausgenommen das Uhrentürmchen des Bahnhofs (1), das mit eisenbahnlicher Strenge die genaue Zeit anzeigt, obwohl die Züge sich nicht selten darüber hinwegsetzen. Das spitze Krankenhaustürmchen (2) hat einen neuen Platz vor dem Alten-heim gefunden. Es war ein Glockenturm und stand auf dem Aufzugschacht, krönte aber weniger diesen als die neugotische Hauskapelle, die für die Franziskanerkrankenschwestern wie für viele Kranke der Mittelpunkt des Hauses war. Die 1950 eingeweihte evangelische Kirche (3) am Hoveloh trägt ein kleines Gehäuse mit Satteldach für die Glocke, die zu den Gottesdiensten geläutet wird. Ein bewusst bescheidenes Glockenhäuschen, das die Zeichen einer ganz anderen Zeit zeigt als der Turm von St. Lambertus. Vier Prozessionskapellen, an der Mühlenflut (4), an der Altefeldstraße (5), Greives Kapelle am Großen Prozessionsweg (6) und die Kapelle an der Nordkirchener Straße (7), dienten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und zum Teil auch heute noch als Segensstationen bei den Fronleichnamsumgängen. Die Kapelle am Stift (7) wurde 1909/10 aus den Steinen des abgebrochenen Kirchturmes erbaut. Sie verkürzte den Weg der Prozession etwas, denn vorher ging man von Greives Kapelle zur Kapelle am Gasthof Frenking, die dann rund 40 Jahre „außer Dienst“ stand, bis sie 1950 abgebrochen wurde. Auch sie hatte ein relativ hohes schlankes Türmchen und war in neugotischen Formen erbaut. Ein Außenseiter unter den Ascheberger Türmchen war das auf dem Dach der Grundschule (8). 1938 wurde es als Geburtsglockentürmchen von den Nazis erbaut. Es sollte die Geburt eines jeden Neubürgers des Großdeutschen Reiches verkünden. Nach 1945 geriet es in Vergessenheit. 1994 wurde es komplett vom Dach genommen, weil man über eine weitere Verwendung nachdenken wollte, 1995 ließ man es zerschlagen. Zwei Hofkapellen, eine auf dem ehemaligen Hof Schulze Heiling (9) an der Nordkirchener Straße in der Westerbauerschaft, die andere auf dem Hof Schulze Pellengahr (10) in der Osterbauerschaft, haben ebenfalls ein Glockentürmchen. Das auf der neugotischen Kapelle bei Pellengahr läutet noch immer, das bei Schulze Heiling wurde schon vor Jahren gestohlen, als der damals leer stehende Hof völlig ausgeraubt wurde. Auf Schulze Pellengahrs Wohnhaus steht noch ein weiteres Glockentürmchen (11). Es hatte einst eine besondere Bedeutung, denn es läutete Anfang und Ende der Arbeitszeiten und der Mittagspause ein, wurde also mal gern, mal ungern, gehört und erinnert heute an eine Arbeitswelt, die der Vergangenheit angehört. Türme sind praktisch, weil man sich an ihnen orientieren kann. Viele sind Herrschaftszeichen und zur Einschüchterung gebaut, Andere sind protzig und wirken lächerlich. Aber wohl alle sind „Grüße aus der Heimat oder aus der Ferne“, wie die Poeten früher sagten. Das gilt auch in anderer Hinsicht: Wenn sie hoch genug sind, tragen sie Sendestationen und lassen per Handy grüßen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Barocke Hochaltar
|
Als die 1524 eingeweihte Kirche im Jahre 1740 endlich einen Chorraum erhielt, bekam sie auch einen neuen Altar im damals herrschenden Barockstil. Er blieb für rund 140 Jahre der Mittelpunkt der Kirche, bis er 1885 durch einen neuen Altar im Stil der wiederbelebten Gotik ersetzt wurde. Dieser Altar wurde für die heute älteren Katholiken „unser Altar“, und viele bedauerten, dass er 1959 dem heutige weichen musste. Damals war zuerst ein moderner Altar im Gespräch. Doch die Pfarrgemeinde kaufte dann, angeregt durch einen Hinweis von Baron Landsberg, Drensteinfurt, einen von der Diözese Paderborn in Holland ersteigerten Barockaltar aus Ammersfoort. Aber er erwies sich für die Ascheberger Kirche als zu niedrig und das mitgelieferte Bild für den Raum zwischen den Säulen als zu klein. In Amersfoort war der leere Platz rund um das Bild durch eine breite Umrahmung ausgefüllt gewesen, die aber nicht mehr vorhanden war. Deshalb kam man auf den wenig glücklichen Gedanken, einen gefalteten blauen Vorhang hinter das Bild zu hängen, so dass die leeren Stellen kaschiert waren. Damit galt dieses Problem als vorläufig gelöst, aber zufrieden konnte man nicht sein. |
 |
|
Um den Altar aufzustocken, damit er an das Gewölbe heranreichte, hatte man eine wesentlich bessere Idee: Man stellte ein Gottvaterrelief mit Putten, das noch von dem alten Barockaltar übrig geblieben war und bei der Familie Gisa-Frenking aufbewahrt wurde, auf den oberen Abschluss. So ist es heute noch. Am 20. Dezember 1959 (Sonntag) wurde der Altar durch Dechant Hörster, Bockum-Hövel, eingeweiht. Pfarrer Heinrich Plugge war damals krank und wurde in der Raphaelsklinik behandelt. Der Altarraum hatte ein völlig neues Gesicht bekommen. Der gotische Altar war so niedrig gewesen, dass man 1885 über ihm ein großes Fenster in die Chorwand gebrochen hatte, das nun wieder zugemauert worden war. Von nun an fehlte das vertraute farbige Sonnenlicht, das besonders im Sommer schon bei der Frühmesse den Chorraum verklärt hatte. Auch die Wandmalerei war mit weißer Farbe überdeckt worden. Chorgestühl und Kommunionbank wurden ausgetauscht. Alles wirkte reichlich fremd und ungewohnt. Die festlichen Weihnachtstage 1959 überstrahlten aber zunächst alles, und danach musste man sich doch an das Neue gewöhnen. Das fiel den jungen Leuten wesentlich leichter als den alten. Hilfreich war dabei, dass amtlich mitgeteilt wurde, der alte Altar sei künstlerisch wertlos gewesen. Mit dieser zeitbedingten Meinung trösteten sich manche Ascheberger noch lange. Auch der blaue Vorhang hinter dem Altarbild verschwand eines Tages, denn 1962 kaufte die Pfarrgemeinde ein etwas größeres Bild, eine Kreuzabnahme von einem unbekannten Maler, das die Gemeinde Kirchhundem im Sauerland anbot. Die obere Seite war als Dreipass ausgebildet, so dass wieder oben rechts und links leere Stellen entstanden. Schon 1962 schlugen die Architekten Kösters und Balke vor, dort Rosetten anzubringen, um diese absolut „unbarocken Löcher“ zu füllen, aber dazu kam es bis heute nicht. Das holländische Altarbild, das Jesus und die Frau am Jakobs-Bronnen darstellt, wurde auf die Orgelbühne gehängt. Dass es von dem holländischen Maler Abraham Bloemaert (1564 – 1651) stammte, wusste damals niemand. Erst 1994 meldete sich der Kunstwissenschaftler Dr. Guido Seelig aus Berlin, der von dem bis dahin für verschollen gehaltenen Bild gehört hatte, und identifizierte es als ein Bloemaert-Werk. 1996 kam der Genfer Professor Dr. Marcel Röthlisberger nach Ascheberg und bestätigte diese Diagnose. Das Bild stammt von 1605 und der Altar von 1696, gehörten also ursprünglich nicht zusammen. Fast ein halbes Jahrhundert steht der neue Altar, der übrigens fast 200 Jahre älter ist als sein Vorgänger, jetzt schon in der St. Lambertus-Pfarrkirche. Er ist allmählich zu einem alten geworden, jedenfalls für viele, denn immer weniger Ascheberger können sich an die Zeit vor 1959 erinnern. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Kirchhundemer Altarbild
|
Die vierzehnjährige Theresia Erwes aus Kirchhundem im Sauerland muss ein fleißiges und braves Mädchen gewesen sein. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls beim Lesen ihres Aufsatzes von 1874 "Beschreibung meines Heimatortes", in dem sie ihre Liebe zum Elternhaus und zu ihrer Heimat, "dem geliebten Sauerland", in wohlgesetzten Worten zum Ausdruck bringt. Sie hat gewiss ein Lob dafür bekommen und deshalb ihren Aufsatz gut aufbewahrt. Ihre rührend altklugen Sätzen preisen die Schönheit der Natur, die Wohlhabenheit der Kirchhundemer und ihre Treue zur katholischen Kirche "besonders in den trüben Zeiten". Alle halten fest an Rom, Altkatholiken gibt es fast gar nicht, und das "neue deutsche Kaiserreich" kümmert sie wenig. Mit spürbarer Freude spricht das Mädchen auch von der Einrichtung der Kirche: "Das Innere derselben ist sehr prachtvoll, und die drei Altäre sind reich geschmückt. Besonders schön ist das Bild im Hochaltar, die Abnahme Christi vom Kreuze." Dieser letzte Satz ist es, der in Ascheberg besondere Aufmerksamkeit erregt, obwohl das Mädchen noch mehr Interessantes über Land und Leute zu berichten weiß, denn das Bild "Abnahme Christi vom Kreuz" wurde aufgrund eines Beschlusses des Kirchenvorstandes von St. Peter und Paul in Kirchhundem vom 8. Juni 1962 an die Kirchengemeinde St. Lambertus in Ascheberg verkauft. Sein Wert war auf 6000 Mark geschätzt worden, aber wegen des starken Verfalls und der nötigen Restaurierung konnte die Kirchengemeinde Ascheberg es für 3000 Mark erwerben. |
 |
|
Zwischen dem Aufsatz von Theresia Erwes aus dem Jahre 1874 und dem Verkauf des Bildes im Jahre 1962 liegen 88 Jahre, in denen es "beschädigt und so dunkel geworden ist, dass man das Bildthema kaum noch erkennen konnte. Liturgisch hatte es keine Bedeutung mehr, und so staubte es unbeachtet von den Kirchenbesuchern still vor sich hin." So berichtet Fritz Neuhaus, ein Kenner der Kirche von Kirchhundem und ihrer Geschichte. Theresia Erwes konnte das Bild noch acht Jahre in der mittelalterlichen, aber barock eingerichteten Pfarrkirche bewundern, denn 1882 wurde der Hochaltar abgebrochen und durch einen neugotischen ersetzt. Die Kreuzabnahme verbannte man auf die Orgelbühne, an die Wand der alten "Heimlichkeit", eines Verstecks in Notzeiten. Ähnliches geschah auch zur gleichen Zeit in Ascheberg. Auch hier wurde die barocke Ausstattung entfernt, und nach und nach zog die neue Gotik ein. Dahinter stand nicht nur die Notwendigkeit einer Restaurierung, sondern auch der im kirchlichen Amtsblatt zum Ausdruck gebrachte Wunsch des münsterschen Bischofs Johann Georg Müller, der ein Kunstkenner und Freund der mittelalterlichen Kunst war. Die Kirche zu Kirchhundem wurde 1920 von Professor Liese und 1940 von Dr. Overmann beschrieben. Beide erwähnen die Kreuzabnahme nicht. "Erst in den fünfziger Jahren wurde man bei der umfangreichen Renovierung der Kirche auf das Gemälde und auf zwei weitere, von denen man eines auf dem Speicher des Pfarrhauses gefunden hatte, aufmerksam. Man wollte sie restaurieren lassen. Damals hatte die Kirchengemeinde aber erhebliche Mühe, die Mittel für die Kirchenrenovierung und für andere Projekte, z.B. den Kindergarten, aufzubringen, so dass die Restaurierung der Bilder gleichzeitig mit den anderen Aufgaben nicht zu finanzieren war. Pfarrer und Landeskonservator wollten die reizvolle Aufgabe aber nicht hinausschieben, und so kam es zum Verkauf des größten der drei Bilder an die Pfarrgemeinde St. Lambertus in Ascheberg. Den Verkaufserlös setzte man in Kirchhundem für die Restaurierung der restlichen beiden Gemälde ein, die heute im Altarraum der Kirche hängen." So weit Fritz Neuhaus. Welches Interesse hatte man in Ascheberg an diesem Bild? Man suchte damals ein Gemälde, das nach Thema und Format als Altarblatt für den 1959 eingebauten Barockaltar aus Amersfoort, Holland, geeignet war. Der neugotische Hochaltar war entfernt worden, und der 1737/40 von Johann Conrad Schlaun erbaute Chor sollte wieder einen barocken Altar erhalten. Der holländische Altar hatte zwar ein Altarbild, aber es war zu niedrig. Deshalb hängte man zuerst einen gerafften blauen Vorhang zwischen die Altarsäulen und das mitgelieferte Bild "Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen" davor. Diese Lösung konnte niemanden befriedigen. Man wusste nicht, dass das Altarbild in der Seminarkirche in Amersfoort unten und oben durch eine ornamentale Rechteckfläche "vergrößert" worden war, denn diese Stücke waren nicht mehr vorhanden. Das Kirchhundemer Bild erfüllte die Ascheberger Wünsche und man erwarb es, als das Paderborner Generalvikariat und die Restaurationsfirma Ochsenfarth es anboten. Seine obere Kante ist als Dreipass ausgebildet, es füllte also auch die vorgesehene rechteckige Fläche nicht vollkommen aus. Das nahm man hin, und so sind bis heute oben rechts und links kleine Leerflächen geblieben, die streng genommen etwas unbarock wirken. Die Kreuzabnahme ist ca. zwei Meter breit und drei Meter hoch. Der schwere muskulöse Leichnam des Gekreuzigten beherrscht das Bild, sein linker Arm hängt herab, der rechte ist noch am Kreuz befestigt. Die Beine sind stark nach rechts verschoben, die geschwollenen Füße mit den Nagellöchern berühren fast das Gesicht der am Boden zusammensinkenden Mutter Maria, die von einer Frau aufgefangen wird. Links unten greift ein junger Mann mit ausgestreckten Armen nach der Mutter Jesu. Fünf Männer in der oberen Hälfte des Bildes bemühen sich, den Toten vom Kreuz abzunehmen. Einer von ihnen, vielleicht der Jünger Johannes, schaut mit ernstem Gesicht zu Jesus empor und stützt seinen Leichnam unter der linken Achsel. Ihm gegenüber sind Rücken und Hinterkopf eines Mannes zu sehen, der mit dem rechten Unterarm den Leichnam hält. Die Männer wirken konzentriert und angestrengt. Ihre faltenreichen Gewänder und die der Frauen füllen den größten Teil der Bildfläche. Alle Personen bewegen sich mit ausholenden Gesten und bewirken so die typisch barocke Lebendigkeit des Bildes. Zwei schräg angelegte Balken stützen das Kreuz. Einer wird von einem Mann gehalten, dessen Gesicht von seinem muskulösen Arm halb verdeckt wird. Diese Balken und das Werkzeug - eine Zange und ein Hammer aus glänzendem Eisen - sind Zeichen einer Sachlichkeit, die in der christlichen Kunst zum Ausdruck des Glaubens gehört. Eine Eigenart des Malers: Von den sieben erkennbaren Gesichtern wirken sechs durch ihre Ähnlichkeit wie nahe Verwandte. Die gleichen herabgezogenen Mundwinkel und aufgewölbten Oberlippen und die gleiche Nasenform bewirken diesen Eindruck. Auch der tote Jesus ist von dieser Ähnlichkeit nicht ausgenommen. Der Maler und das Jahr der Entstehung des Bildes sind nicht bekannt. Da aber der Paderborner Weihbischof Fricke am 28. Juli 1647 den Hochaltar und einen Marienaltar (Seitenaltar) in Kirchhundem konsekriert hat, darf man annehmen, dass die Kreuzabnahme spätestens in diesem Jahr entstanden ist. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass das Bild später gemalt wurde und auf einem anderen Wege und unter unbekannten Umständen in den Hochaltar gelangt ist. Das Verkündigungsbild im Kirchhundemer Marienaltar wurde 1655 von dem Richter Martin Schönberg aus Bilstein und seiner Frau Anna Maria Beckers gestiftet. Das ist durch den Widmungstext auf dem Bild erwiesen. Die Kreuzabnahme in Ascheberg trägt keine Widmung, aber vielleicht stammt sie auch von diesen Stiftern. Das Amersfoorter Altarbild "Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen" wurde 1962 auf die Orgelbühne verbannt, wo es seitdem unbeachtet hängt. Im Jahre 1994 meldete sich der Berliner Kunst-historiker Dr. Guido Seelig mit der Frage nach diesem Bild und 1996 der Genfer Kunsthistoriker Prof. Roethlis-berger mit der gleichen Frage. Beide hatten Arbeiten über den holländischen Maler Abraham Bloemaert (1564-1651) veröffentlicht und suchten nach einem verschol-lenen Altarbild, das er 1605 gemalt hatte. Es stellte das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobs-brunnen dar. Beide Herren schauten sich das Bild auf der Ascheberger Orgelbühne an und identifizierten es als ein Werk Abraham Bloemaerts, das dem Utrechter Manierismus zugerechnet wird. Das war bislang in Ascheberg völlig unbekannt gewesen, und auch die Kunstexperten, die 1959 den Ankauf des Amersfoorter Altars begleitet hatten, waren an dem Maler des Bildes nicht interessiert, denn manieristische Malerei galt damals nicht viel. Da der Altar selbst erst 1696 entstand, muss sich das Bloemaert-Bild rund 90 Jahre an einem anderen Ort befunden haben, vielleicht ebenfalls in einem Altar. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Strahlenmadonna
|
Zu Füßen der Doppelmadonna in der Ascheberger Kirche ist der lateinische Satz zu lesen: "Agnes Kösters vidua Antony Torlinsen dedit Anno 1690" Das heißt: "Agnes Kösters, die Witwe von Anton Torlinsen stiftete im Jahre 1690" (dieses Bild). Streng genommen müsste es heißen: ....dono dedit. Aber aus welchen Gründen auch immer haben der Bildhauer und seine Auftraggeberin das dono ausgelassen. Agnes, die Witwe von Anton Torlinsen, hieß mit ihrem Mädchennamen Kösters. Sie war wohl die Tochter des Ascheberger Küsters, und vermutlich hat ihr Ehemann Anton Torlinsen das Küsteramt von seinem Schwiegervater übernommen. Der Grund für das teure Geschenk an die Kirche war ein böses Erlebnis der Agnes Torlinsen. Sie hatte sich bei Dunkelheit in der Davert verirrt und in ihrer Angst gelobt, ein solches Marienbild zu stiften, wenn sie heil nach Hause käme. So wurde es, durchaus glaubwürdig, erzählt, und so wird es auch wohl gewesen sein. Die beiden Madonnen- und Jesuskindfiguren sind auf den ersten Blick völlig gleich. Aber bei genauerem Hinschauen entdeckt man Unterschiede im Gesichts-ausdruck. Die eine Maria wirkt etwas strenger, die andere lieblicher. Heute ist die lateinische Inschrift dem Altar zugewandt, früher dagegen dem Turm, wie alte Fotos beweisen. Der große Ring unter der Figur ist in die künstlerische Gestaltung mit einbezogen, dient aber nur dem bequemeren Herabziehen zu Pflegearbeiten. |
 |
Unsere Kirche früher
|
Wie sah das Innere unserer Kirche vor etwa 50 Jahren aus, bevor die von vielen älteren Aschebergern bedauerten Veränderungen stattfanden? Mit dieser Frage ist keine Bewertung beabsichtigt, weder der damaligen noch der heutigen Einrichtung, sondern nur eine Beschreibung. Von der Veränderung sind alle Teile der Kirche betroffen: Chor, Langhaus, Turmkapelle und Orgelbühne. Im Chorraum stand vor der Ostwand ein neugotischer Hochaltar. Dieser bestand aus dem Altartisch und dem Aufbau. Der Tisch wurde getragen von einem quadratischen Block in der Mitte, der mit einem Vierpass und einem gleicharmigen Kreuz darin geschmückt war. Rechts und links davon standen je zwei Heiligenfiguren. An den Enden rechts und links stützte sich die Tischplatte auf je eine schlanke Säule. Die Namen der Heiligen sind nicht bekannt. Der Aufbau bestand aus vier "Heiligenhäuschen" mit spitzen Giebeln und in der Mitte einem etwas breiteren Tabernakel, ebenfalls mit einem Giebel. Auch hier sind die vier Heiligen nicht bekannt. Der Tabernakel bestand aus einem unteren, etwas niedrigeren und verschließbaren Teil für die Kelche und darüber einer Stellfläche für die Monstranz. Zwischen diesen krabbenbesetzten Giebeln standen schmale Fialen. Der Altar dürfte etwa drei bis vier Meter hoch gewesen sein. Er stand auf einem dreistufigen Podest. |
 |
|
Oberhalb des Altars befand sich ein großes Rundbogenfenster, das nur wenig schmaler als der Altar war und bis zum Gewölbe reichte. Im oberen Teil des Fensters waren in einer ovalen Mandorla die Dreifaltigkeit in Form eines Gnadenstuhls (Gottvater hält das Kreuz mit dem Sohn Gottes vor sich, darunter schwebt die Heilig-Geist-Taube). Die Darstellungen darunter sind nicht mehr bekannt. Neben diesem Fenster war rechts der hl. Petrus und links der hl. Paulus an die Wand gemalt. Über dem Fenster sah man fünf runde Brustbilder weiterer Heiliger, die ebenfalls nicht bekannt sind. Es könnten Lambertus, Johannes d.T., Maria, Josef und Katharina gewesen sein. Die gesamte Ostwand, die Seitenwände und die Gewölbe waren lückenlos farbig bemalt mit Ornamenten, teils mit Steinquadern, die Gewölbe mit spiralenförmigen Kreisflächen. In den Ecken neben dem Altar standen links ein Herz-Jesu und rechts eine Muttergottes mit Jesuskind auf einer schlanken Säule. Zwischen den Sakristeitüren und dem Chorbogen waren an beiden Seiten die fünfsitzigen Chorstühle aufgestellt, die sich jetzt in Ostenfelde befinden. Heute fehlt aber an beiden Seiten je eine Holzfigur, deren Bedeutung nicht bekannt ist. Der Chorraum schloss mit zwei Stufen am Chorbogen zum Langhaus hin ab. Darauf stand die Kommunionbank, die in der Mitte durch ein zweiteiliges Tor aus eisernen Ornamenten unterbrochen war. Altar und Kommunionbank bestanden aus weißem Marmor. Die gesamte Chorgestaltung war neugotisch geprägt. sie entstand in den Jahren nach 1870 und löste damals die barocke Einrichtung von 1740 ab. Alle zehn Langhausfenster zeigten Szenen aus dem Leben der Heiligen, die nicht mehr bekannt sind. An den Ostwänden der Seitenschiffe standen Seitenaltäre, links der Kreuzaltar mit Maria und Johannes neben dem Gekreuzigten. Diese Gruppe befindet sich heute in der Trauerhalle auf dem Friedhof, allerdings ohne die ursprünglichen Farben. Rechts stand der Katharinenaltar mit einer großen Katharinenfigur in der Mitte und der hl. Barbara links (Attribute: Palmzweig und Turm, der aber zuletzt fehlte) und der hl. Appollonia rechts neben ihr (Zange mit einem Zahn). Neben dem Katharinenaltar stand links in einer spitzbogigen Nische eine zweite Figur der hl. Katharina. Sie war ursprünglich von einer gotischen Umrahmung umgeben, die aber zuletzt schon fehlte. Heute steht sie an der südlichen Seitenwand. Beide Seitenaltäre waren aus dunkel gebeiztem Holz mit goldenen und wenig farbigen Ornamenten im gotischen Stil. Rechts neben dem Kreuzaltar stand die Pietà, die heute in der nördlichen Turmkapelle steht. Über ihr hing das sog. Missionskreuz, ein großes Holzkreuz mit den Jahreszahlen der stattgefundenen Volksmissionen unter dem Motto "Rette deine Seele" Über dem Chorbogen war ein großes Gemälde zu sehen, das den gekrönten Christus in einer Strahlenmadonna auf dem Regenbogen sitzend zeigte. Er hielt in der linken Hand ein geöffnetes Buch mit den Buchstaben Alpha und Omega und erhob die rechte mit den ausgestreckten Schwurfingern. Links kniete Maria, rechts Johannes der Täufer, ein Kreuz mit dem Spruchband „Ecce Agnus Die“ in der Hand haltend. Rechts und links daneben kniete ein anbetender Engel. Die Langhauswände waren mit einem teppichartigen Sockel bemalt. Darüber hingen die 14 Stationen des Kreuzwegs in gotischer Umrahmung. Vier ebenfalls gotische Beichtstühle standen an den Seitenschiffwänden. Die sechs Säulen trugen die Kanzel und fünf große steinerne Heiligenfiguren unter gotischen Baldachinen: vorn links St. Josef mit dem Jesuskind, in der Mitte St. Anna mit Maria, hinten St. Michael, in der Mitte rechts der hl. Aloysius, hinten der hl. Antonius von Padua und vorn rechts die Kanzel. Die Bänke waren eng und unbequem und zu den Gängen hin am Boden durch ein von vorn bis hinten durchgehendes Brett miteinander verbunden, so dass man beim Hinein- und Hinausgehen die Füße über diese Barriere heben musste, was fremde Kirchenbesucher leicht zum Stolpern brachte. Die nördliche Turmkapelle war als Taufkapelle eingerichtet. Hier stand der spätgotische Taufstein mit dem barocken Deckel, das einzige echte gotische Kunstwerk der Kirche. An der Südseite der südlichen Turmkapelle war ein kleiner Nebeneingang, der heute zugemauert ist. Der kleine Raum dient jetzt als Beichtraum. Unverändert blieb auch das Kriegerepitaph an der Wand daneben. In dieser Turmkapelle stand auch das barocke Bild der Annaselbdritt. Es gibt einige Fotos, die die alte Einrichtung belegen, wenigstens teilweise. Leider fehlen Beschreibungen und Abbildungen der Fenster. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Gründung des Kunst- und Kulturvereins
|
Die Gründung des Kunst- und Kulturvereins Ascheberg im September 1997 lässt die Erinnerung wach werden an ein ähnliches Ereignis, das im Dezember 1977, also vor genau 20 Jahren, in der Ascheberger Osterbauerschaft stattfand: im Gasthof zur Mühle begann der Wirt Karl Heerdegen, seinen Gästen neben Speisen und Getränken auch Dichterlesungen, Kunstausstellungen und Konzerte anzubieten. Er hatte den Gasthof von der Familie Spleiter gepachtet und ihn "Kaffeehaus und Schankwirtschaft von Oma Theresia Spleiter" genannt. Die damals siebzigjährige Oma Spleiter unterstützte Heerdegens Pläne, indem sie mit ihrem Konterfei auf Plakaten, Briefbögen und Rechnungen für die Gaststätte warb. Schon ein Jahr später war das Gasthaus in der Presse, im Hörfunk und auch im Fernsehen als "Kulturmühle, Jazzmühle, Literaturmühle" im Gespräch. Heerdegen schätzte diese Namen nicht sehr, wie er 1980 im Jahrbuch des Kreises Coesfeld schrieb. Seine Kneipe war eben keine Mühle, er sah in ihr einen der Landgasthöfe, die einst Reisen, Übernachten, Essen, Trinken, Gerichthalten, Handel, Pferdewechsel, Postbe-förderung und anderes ermöglicht hatten. Was da an menschlicher Kommunikation entstand, sich entwickelte und wieder verging, das faszinierte ihn und das wollte er mit seinem Angebot an Dichtung, Gesang, Musik und Bildern auf eine neue Weise und auf der Ebene der Kunst wirksam werden lassen. Trotzdem nannte er auf einem Plakat im Dezember 1978 seine Gaststätte "Literatur-Mühle". Spleiters Gasthof ist ein altes Fachwerkhaus aus der Zeit um 1830 und die Gaststube ein hoher Raum nach Art der alten Bauernküchen mit einem offenen Kamin aus Sandstein und mit kleinen Türen aus Messing daran. Über dem Keller gibt es die Upkammer, die die Gäste über eine dreistufige Treppe erreichen. An der Wand hing damals ein großes Gemälde von Heinrich Götting, das den Gasthof und die dazugehörende Bockwindmühle darstellte, ein Geschenk der Stadt Münster für Clemens Spleiter, der die Mühle 1938 dem münsterschen Konditor Albin Middendorf verkauft hatte. Dieser schenkte sie der Stadt. Heute gehört das Bild Spleiters Tochter in Münster. In diesem altmodisch-gemütlichen Raum bewirtete Heerdegen seine Gäste, vorwiegend Leute im Alter von 20 bis 40 Jahren. Ihre Autos verstopften den kleinen Platz vor dem Gasthaus, denn sie kamen aus dem ganzen Münsterland. Sie wollten Schriftsteller, Dichter, Maler und Zeichner, Sänger und Musiker sehen und hören, von denen überall die Rede war. Die erste von ihnen war die sehr junge und schon sehr bekannte Jutta Richter, die auch heute im Ascheberger Kulturverein stellvertretende Vorsitzende ist. Sie hatte schon im Winter 1976 Karl Heerdegen davon überzeugen können, dass sein Gasthof zur Mühle künftig ein Treffpunkt für Schriftsteller aus dem Münsterland und ihre Leser sein müsse. Max von der Grün kam Anfang 1978, und die Gaststube platzte aus allen Nähten. Hier erlebte man "Kultur ohne Krawatte", so Günter Benning im Jahrbuch Kreis Coesfeld 1979. Siegfried Mrotzek, Stefan Hermlin, Wolfdietrich Schnurre wurden eingeladen, ebenso Walter Kempowski und Günter Grass, der im November 1981 auch seine Grafiken ausstellte. Ein Zeitungsfoto zeigt den damaligen Ascheberger Bürgermeister Bernhard Schütte-Nütgen im Gespräch mit Grass. Karl Oppermann, Aldorna Gustas, die Jazz-Rock-Formation Ceddo, die Chansonette Barbara Thalheim, der Fotograf Armin Stremmler, der Maler-Dichter Paul Seuthe, die Jazz-Gruppe Katamaran, Jo Pestum, Friedel Thiekötter, Norbert Johannimloh, Helder Yureen kamen, und Everhard Drees erzählte in einer Matinee europäische Märchen. Richard von Soldenhoff stellte die Bücher von Kurt Tucholsky aus, und Josef Reding las aus ihnen vor. Dass auch Rainer Schepper und Dr. Heinrich A. Mertens, der damalige Kreiskulturbeauftragte, in die Osterbauerschaft kamen, war eigentlich selbstverständlich. "Inne Osterbur was ümmer wat los!" sagte Wilhelm Höckesfeld, ein temperamentvoll erzählender Bauer, oft. Aber als Karl Heerdegen 1985 plötzlich starb, ging auch seine "Kulturmühle" ein. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Windmühle und Strontianitbergbau in der Osterbauerschaft
|
Wenn um 1900 der Windmüller Fleckmann in der Osterbauerschaft aus dem Obergeschoss seiner Bockwindmühle an der Straße nach Drensteinfurt zu seinen Nachbarn am Rande der Davert hinüberschaute, sah er Männer, die weder pflügten, noch säten, weder Korn schnitten noch Kartoffeln und Rüben ernteten, sondern schwere mit grau-silbrigem Gestein beladene Pferdewagen über die schlechten Wege nach Drensteinfurt zum Bahnhof führten. Sie transportierten Strontianit, ein kristallines Mineral, das – wie überall erzählt wurde – in den Zuckerfabriken in Dessau und anderswo sehr begehrt war, denn man konnte mit ihm Zucker aus der Melasse gewinnen, einem nicht wasserlöslichen Rückstand bei der Zuckerrübenverarbeitung. Seit rund 30 Jahren waren damals im südlichen Münsterland zwischen Altenberge und Oelde kleine Bergwerke entstanden, in denen dieses Gestein abgebaut wurde. Die Strontianitgruben gehörten den Grundbesitzern, die an jeder geförderten Tonne verdienten, manchmal auch nur zu verdienen hofften, denn viele Gruben mussten schneller wieder geschlossen werden als sie ausgebaut worden waren. Aber immer wieder versuchten die Unternehmer an anderen Stellen ihr Glück. Der katholische Pfarrer und plattdeutsche Dichter Dr. Augustin Wibbelt, gebürtig aus Vorhelm, schrieb über das Strontianitfieber einen Roman unter dem Titel „De Strunz“ (Der Strontianit) und schilderte darin das Wohl und Wehe der in den Sog der Strontianitgeschäfte geratenen Bauern, die bald begreifen mussten, dass ihnen nur die toten grauen Mergelhalden blieben, als eine Grube nach der anderen die unrentable Förderung einstellte. In England fand man Coelestin, schwefelsaures Strontian, das dem kohlen-sauren Strontian aus dem Münsterland ähnlich, aber leichter zu beschaffen war und alle Preise verdarb. Dr. Martin Gesing, Beckum, hat die Strontianit-Geschichte und Bergbautechnik in seinem Buch“ Der Strontianitbergbau im Münsterland“ sehr ausführlich beschrieben. Schon 1921, als noch einige Strontianitgruben in Betrieb waren, verfasste Josef Becker aus Ascheberg seine Doktorarbeit über dasselbe Thema. Die Grube Wickensack auf dem Gelände der GfS (Eberstation) arbeitete noch bis 1945, weil – wie Spötter meinten – sich die Nazis davon einen Beitrag zum „Endsieg“ versprachen. Die Gemeinde Ascheberg versuchte um 1960, das Wasser der Grube für eine eigene zentrale Wasserversorgung zu nutzen. Aber das war nicht möglich. Der Windmühlenbesitzer Fleckmann wusste damals auch schon, dass die Zeit der Windkraft ihrem Ende nahe war. Überall installierten Unternehmer aller Gewerbezweige Dampfmaschinen, und längst sprach man von der Elektrizität, die eines Tages Motoren antreiben würde. Seine Bockwindmühle hatte sein Großvater zusammen mit dem Nachbarn Theodor Wiggermann 1852 für 600 Taler von der Stadt Münster gekauft, wo sie vor dem Ägidiitor gestanden hatte. Im Winter 1852/53 hatte man sie auf Schlitten nach Ascheberg gebracht und für weitere 768 Taler betriebsfähig gemacht. 1854, 1857, 1859, 1860 und 1872 wurden weitere Reparaturen und Ergänzungen notwendig. 1888 kaufte Fleckmann seinem Compagnon Wiggermann seine Anteile ab und betrieb die Mühle allein. 1898 baute er eine Dampfmaschine neben die Windmühle, um nicht allein vom Wind abhängig zu sein. Bis 1925 blieb die Windmühle in Betrieb. Dann wurde die Dampfmühle in das zweigeschossige Gebäude verlegt, das heute noch neben dem Gasthaus steht. Die Windmühle verfiel allmählich. 1938 kaufte der münstersche Konditor Albin Middendorf die ruinöse Mühle von dem neuen Gastwirt Clemens Spleiter und schenkte sie der Stadt Münster, die sie restaurierte und am Aasee aufstellte. Im Hitlerkrieg wurde sie durch Bomben zerstört. Während die Strontianithalden kaum beachtet werden, vielleicht von wenigen Steinsammlern abgesehen, die hin und wieder ein Bröckchen Strontianit finden, erinnert der „Gasthof zur Mühle“, der seit 2006 „Neue Mühle“ heißt, an die alte Bockwindmühle. Hier hing früher ein Gemälde der Windmühle über dem Treppchen zur Upkammer, das eine Tochter von Clemens und Theresia Spleiter geerbt und nach Münster mitgenommen hat. Außerdem gibt es einen Holzschnitt von Heinrich Everz, Coesfeld, der weit verbreitet ist. Auch gab es im frühen 20. Jh. an der heutigen Bundesstraße 58 eine Gasquelle, eine Windmühle und eine Schule. Von allen finden sich heute noch Reste, von der Windmühle den Gasthof zur Mühle, der heute „Neue Mühle“ heißt, von der Schule das westliche Nachbarhaus und von der Gasquelle rund zweihundert Meter östlich auf der gegenüber liegenden Seite der B 58 eine Konstruktion aus rostigen Eisenrohren. Während der Name des Gasthofs vermutlich an eine ehemalige Mühle in der Nähe erinnert, weckt das Eisengebilde keinerlei Erinnerungen an Einrich-tungen oder Ereignisse der Vergangenheit. Seine Bedeutung ist nicht zu erkennen. Auch die ehemalige Schule verbirgt sich heute in einem relativ hohen Gebäude, dessen große Fenster um mehr als die Hälfte verkleinert sind und als Schulklassenfenster nicht mehr erkannt werden können. Aber alle haben eine Geschichte. Zuerst war die Mühle das Tagesgespräch in Ascheberg, jedenfalls in der Osterbauerschaft. Der Bauer Theodor Wiggermann und der Gastwirt Heinrich Fleckmann kaufte 1852 für 600 Taler von der Stadt Münster eine Windmühle, die vor dem Ägidiitor gestanden hatte. Sie wurde im Winter 1852/53 auf Schlitten nach Ascheberg gebracht und für weitere 768 Taler betriebsfähig gemacht. 1854, 1857, 1859, 1860 und 1872 wurden waren Reparaturen und Ergänzungen erforderlich, und 1888 kaufte Fleckmann dem Landwirt Wiggermann seinen Anteil ab und betrieb die Mühle allein. 1898 baute er eine Dampfmühle neben die Windmühle, um nicht allein vom Wind abhängig zu sein. Die Windmühle blieb bis 1925 in Betrieb. Dann wurde die Dampfmühle in das zweigeschossige Gebäude verlegt, das heute noch neben dem Gasthaus steht, und die Windmühle verfiel allmählich. 1938 kaufte der münstersche Konditor Albin Middendorf die ruinöse Windmühle von dem neuen Gastwirt und Müller Clemens Spleiter und schenkte sie der Stadt Münster, die sie restaurierte und am Aasee aufbaute. Im Hitlerkrieg wurde sie durch Bomben zerstört. Die einklassige Schule konnte 1894 eröffnet werden, aber nur nach harten Auseinandersetzungen und allerlei Querelen, denn die Gemeinde Ascheberg wollte die Schule nicht, aber sie musste sie bauen, weil der Kultusminister in Berlin es anordnete. Das Schuljahr 1966/67 war ihr letztes. Dann fuhren alle Kinder mit Schulbussen zur Schule im Dorf. Zehn Jahre nach der Einweihung der Osterbauer-Schule wäre es in der Nachbarschaft fast zu einer Brandkatastrophe gekommen. Dort, wo heute das erwähnte Rohrgebilde steht, wurde von einer Bohrgesellschaft nach Erdöl gebohrt. Am 25. Februar 1904 schoss eine gewaltige Gasmenge aus dem Bohrloch und entzündete sich an einer Petroleumlampe im Bohrturm. Eine riesige Flamme – man schätzte eine Höhe von 15 Metern – brannte tagelang und setzte die Nachbarn, besonders die gegenüber wohnende Familie Schilling, in große Angst. Als es nach Tagen gelang, die Flamme zu löschen, erbaute man ein Rohrsystem, um das immer noch ausströmende Gas durch eine Leitung zu einer Hauptleitung von der Zeche Radbod in Bockum nach Münster zu leiten. Seitdem heißt das rostige Ding Gasquelle und ist auch unter diesem Namen in den topografischen Karten zu finden. Seltsame grau-weiße mit Sträuchern und Wildkräutern bewachsene Mergelhaufen, ca. 5 bis 6 Meter hoch, erinnern sogar an einen Bergbau, der hier etwa zwischen 1880 und 1940/45 betrieben wurde, den Strontianitbergbau. Sehr gründlich hat ihn Dr. Martin Gesing, Beckum, in seinem Buch „Der Strontianitbergbau im Münsterland“ beschrieben. Strontianit war ein sehr begehrtes Mineral – Sr CO3 -kohlensaures Strontian - , das in Zuckerfabriken bei der Entzuckerung der Melasse, einer zähen wasserunlöslichen Masse, gebraucht, aber bald durch das leichter zu beschaffende Coelestin –Sr CO4 – schwefelsaures Strontium – aus England verdrängt wurde. Damit ging der Strontianitbergbau auch in Ascheberg allmählich zu Ende. Einige Bauern verdienten gut dabei, richtig reich wurde niemand. (siehe auch in der Geschichte von Ascheberg) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Galghege
|
Die Galghege liegt an der Lütkebauerschaft westlich der Brücke über die Eisenbahn. Sie umfasst die vier Höfe Rüller-Bergmann, Falke, Gurges (heute Kolb) und Höhne. Was bedeutet der Name „Galghege“? Es gibt an vielen Orten mit Galg zusammengesetzte Flurnamen, und sie werden in der Regel als Hinrichtungsplätze mit einem Galgen gedeutet, wie die Galgheiden am Kappenberger Damm in Münster und in Telgte an der Straße zum Friedhof Lauheide. Der Galgen des Davensberger Gerichtes stand bis zum Ende des ersten Reiches, des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ (1806), im Remberg in der Nähe der Nordkirchener Straße, nach der Überlieferung auf der kleinen Anhöhe hinter dem Hof Bücker, also nicht in der Galghege, sondern rund 1,3 Kilometer von ihr entfernt. Hinrichtungen fanden früher öffentlich statt, auf Plätzen in der Nähe viel benutzter Straßen um der abschreckenden Wirkung willen. Der münsterische Galgen stand auf der nördlichsten Spitze der Galgheide nahe der vielbefahrenen Weseler Straße, etwa am heutigen Polizei-Institut, und auch den Galgen auf der Telgter Galgheide sah man von der Warendorfer Landstraße aus in nächster Nähe. Wenn die Ascheberger Galghege zu irgendeiner Zeit eine Hinrichtungsstätte gewesen sein sollte, dann müsste hier ein ähnlicher Weg vorbeigeführt haben. Das war aber nicht der Fall. Deshalb kann diese einst ziemlich abgelegene Gegend nicht nach einem Galgen benannt sein. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ihr Name zu den Flurbezeichnungen der ältesten Schicht gehört, die schon zur Besiedlungszeit des Ascheberger Raumes, vielleicht zu Beginn des ersten Jahrtausends, oder auch schon früher, entstand. Welcher Sprache er entstammt, weiß niemand. Als der Davensberger Gerichtsherr, vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts, einen Platz für die Hinrichtungsstätte bestimmte, fiel wahrscheinlich die Wahl auf die Galghege, weil man sie wegen ihres Namens für einen ehemaligen Galgenplatz hielt. Aber ihre ungünstige Lage war wohl der Grund dafür, dass man den Galgen nicht dort, sondern im Remberg an der Nordkirchener Straße errichtete, die eine wichtige Verbindung darstellte zwischen den Burgen in Davensberg und Nordkirchen und entsprechend viel benutzt wurde. Mit der münsterischen Galgheide zwischen Weseler Straße und Kappenberger Damm, die heute wegen der Bebauung nicht mehr zu erkennen und auch vielen Anwohnern nicht einmal dem Namen nach bekannt ist, dürfte es sich ähnlich verhalten. Nach Josef Prinz („Mimigernaford“) war sie ursprünglich über 1000 Morgen groß und er- streckte sich von dem Galgen im Norden bis in die Amelsbürener Bauerschaft Loevelingloh, früher sogar bis zum Emmerbach im Süden. Es ist schwer zu verstehen, dass ein so großes Gebiet in seiner Gesamtheit nach dem verhältnismäßig kleinen Galgenplatz an seiner Nordspitze benannt sein sollte. Wahrscheinlich hat man auch in diesem Fall nach den Vorstellungen einer unkritischen Volksetymologie den Galgen dort errichtet, wo schon ein alter, ähnlicher Flurname, hier Galgheide, vorhanden war. Der für Münster (1391) belegte Name Galic-Heide, ursprünglich wohl Galingheide, enthält den Wortstamm gal, der mit den Varianten gel, gil, gol, gul, gäl oder geul und geil als „Wassername“ gilt (verwandt mit Gully und Gülle), also als Bezeichnung für Naßgebiete in alter Zeit. Auch die „Goldene Aue“ im thüringischen Helmetal war ein Sumpfgebiet, keineswegs „golden“, sondern nur „golen“, also nass. Die Telgter Galgheide ist noch heute als teilweise niedrig gelegenes Gelände erkennbar. Es scheint früher feucht gewesen zu sein, wohl auch jetzt noch, denn eine Reihe von Gräben, einige erst in letzter Zeit angelegt, durchzieht das Gebiet. Auch die angrenzende Lauheide trägt einen typischen Feuchtgebietsnamen (Lau wie Lauge). Die Ascheberger Galghege ist ein altes Galing- oder Gal-Gehege. Sie liegt zwischen einst sumpfigen Niederungen, und dieser Lage verdankt sie ihren Namen. Auch die münstersche Galgheide war von Feuchtgebieten durchsetzt wie die benachbarte Vennheide. In der Nachbarschaft von Haus Loevelingloh, Haus Feldhaus und Haus Looz ist ein sich nach Norden absenkender Rest der alten Galgheide noch zu erkennen. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Plaßstrasse
Die Plaßstrasse verbindet westlich der Eisenbahnstrecke die Nordkirchener Straße mit der B 58, überquert die beiden in die Westerbauerschaft führenden Wege Westerhoven und Im Mersch und teilt die Westerbüsche, die früher vom Gasthof Frenking bis zum Hof Landwehr reichten, fast in zwei Hälften. An ihr liegen zwei Höfegruppen: an ihrem südlichen Ende die zum Schliek gehörenden Häuser Lenz, Schneider, Quante, Protz, Rösner und Stattmann und an ihrem nördlichen Ende die Höfe Greive-Ahmann, Hattrup-Uhlenbrock und Rehr. Heute wird die ganze Strecke als Plaßstrasse bezeichnet, früher hieß nur das Stück zwischen der Nordkirchener Straße und der Merschstrasse so. Die eigentliche Plaßstrasse begann im Schliek bei Schneider. Bis zur Schreinerei Stattmann war sie ausreichend befestigt. Wenn allerdings in den nassen Jahreszeiten ein Lkw eine schwere Ladung Holz zu Stattmann bringen wollte, mussten drei Pferde vorgespannt werden. Zwischen Stattmann und der Merschstrasse war die Plaßstrasse ein vernachlässigter Feldweg, "en natt Lock" (ein nasses Loch), außer bei trockenem Hochsommerwetter. Erst in den 50er Jahren wurde sie etwas ausgebessert, ebenso auch das nördliche Anschluss-Stück zur B 58 hin. Wer sie heute befährt, kann leicht feststellen, dass sie früher einmal wie eine Gosse zwischen den Äckern gewesen sein muss, denn das Land an beiden Seiten liegt, besonders im Mittelteil, auffällig höher. Die Plaßstrasse wurde von einem tiefen Bach begleitet, der aus mehreren Quellen im Schliek gespeist wurde. Heute ist an beiden Seiten ein ausgebaggerter Vorfluter. Vor der Merschstrasse vereinigen sie sich mit einem zweiten, fast parallel fließenden Bach, der vom Könnebrack herkommt, bei Dahlhaus die Nordkirchener Straße unterquert und an den Häusern Tönskemper, Pällmann und Schmermann vorbei zur Plaßstrasse fließt. Da die Höfe Ahmann, Uhlenbrock und Rehr etwas höher liegen, umgeht der Bach sie westlich in einem Bogen und verläuft nordöstlich weiter zu den Höfen Heckenkamp und Storkamp und zum Vennkamp und mündet schließlich in den Emmerbach. Beide Bäche führen ihr Wasser von den südwestlichen Anhöhen in einem großen Bogen nordwestlich um das Dorf herum. Es ist aber heute nicht mehr festzustellen, ob der Eisenbahndamm alte Wasserläufe durch den Breil abgeschnitten oder zur Umleitung gezwungen hat. Da der Plaßstrassenbereich rund 3 bis 5 Meter höher liegt als das Dorf, darf man annehmen, dass ursprünglich viel Wasser parallel zur Nordkirchener Straße auch in den 1822 umgeleiteten Bach in der Sandstraße geflossen ist, der nach der Überlieferung wasserreich war und zu Überschwemmungen neigte.
Die Plaßstrasse wurde von einem tiefen Bach begleitet, der aus mehreren Quellen im Schliek gespeist wurde. Heute ist an beiden Seiten ein ausgebaggerter Vorfluter. Vor der Merschstrasse vereinigen sie sich mit einem zweiten, fast parallel fließenden Bach, der vom Könnebrack herkommt, bei Dahlhaus die Nordkirchener Straße unterquert und an den Häusern Tönskemper, Pällmann und Schmermann vorbei zur Plaßstrasse fließt. Da die Höfe Ahmann, Uhlenbrock und Rehr etwas höher liegen, umgeht der Bach sie westlich in einem Bogen und verläuft nordöstlich weiter zu den Höfen Heckenkamp und Storkamp und zum Vennkamp und mündet schließlich in den Emmerbach. Beide Bäche führen ihr Wasser von den südwestlichen Anhöhen in einem großen Bogen nordwestlich um das Dorf herum. Es ist aber heute nicht mehr festzustellen, ob der Eisenbahndamm alte Wasserläufe durch den Breil abgeschnitten oder zur Umleitung gezwungen hat. Da der Plaßstrassenbereich rund 3 bis 5 Meter höher liegt als das Dorf, darf man annehmen, dass ursprünglich viel Wasser parallel zur Nordkirchener Straße auch in den 1822 umgeleiteten Bach in der Sandstraße geflossen ist, der nach der Überlieferung wasserreich war und zu Überschwemmungen neigte. Anscheinend haben die Wasserläufe zwischen der Nordkirchener Straße und der B 58 keine Namen gehabt. Das kurze Stück zwischen Hattrup-Uhlenbrock und Heckenkamp soll Schlot geheißen haben. (Zum Vergleich: ein Schlodbach fließt zwischen Nordkirchen und Selm zur Funne.) Aber der Hauptwasserlauf an der Plaßstrasse hatte einen Namen, nämlich (plattdeutsch) Plaßstruot, d.h. Wasserröhre im Plaß, denn Struot (auch Strot, Strat oder Strut) ist der Namenkunde als Wasserwort bekannt. Da aber Struot lautlich mehr an plattdeutsch Straot = Straße als an Bach oder Fluss erinnert, wurde daraus das hochdeutsche Wort Straße, was besonders plausibel erschien, denn die Plaßstruot war ja wirklich mit einem Uferweg verbunden. (Bei der Sandstraße war es ebenso.) Der öfter vorkommende Flurname Plaß ist eine Sumpfbezeichnung unbekannter Herkunft, hat also nichts mit Platz oder gar Burgplatz zu tun, was Adolf Tibus in seiner Gründungsgeschichte 1885 in spätromantischer Befangenheit schrieb. Ob der auf dem Urmeßtischblatt von 1841 etwas östlich von Greive-Bultmann eingezeichnete Hof Stratmüller seinen Namen der Plaßstruot verdankte, ist nicht mehr festzustellen, aber durchaus möglich, denn der Nachbar Bauer Jelking (Jelkmann) scheint eine Windmühle betrieben zu haben, die hier einen günstigen Platz gehabt hätte. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Kriegerdenkmal an der Lohstraße
|
Am 15. Mai 1927 wurde das Kriegerehrenmal an der Herberner Straße eingeweiht. Nachdem am 20. Juni 1926 der Grundstein gelegt worden war, hatte man fast ein Jahr an dem Bau dieses großen Monumentes gearbeitet. Die Gründungsurkunde vom 29. April 1927 betonte, dass die 359 Mitglieder des Krieger- und Landwehrvereins es als ihre „vornehmste Aufgabe angesehen haben, dieses Ehrenmal für die Gefallenen zu errichten“. |
 |
|
Der damals 63jährige münstersche Bildhauer Anton Rüller, der aus der Ascheberger Galghege stammte, hatte das Denkmal für fünftausend Mark entworfen und aufgebaut. Auf die Flächen des Sockels setzte er die Namen der 154 im Weltkrieg getöteten Soldaten aus Ascheberg und darüber die Wappen der Länder des deutschen Kaiserreiches. Auf die obere Plattform legte Rüller einen verwundeten Löwen, der mit seiner Pranke ein zerbrochenes Schwert hält. Das Tier schaut nach Westen zu Deutschlands ehemaligen Kriegsgegnern Frankreich und England. Auf die Rückseite schrieb man den Spruch: „Sie starben als Helden den Opfertod, als Heimat und Vaterland war’n in Not. / Ruhm ward den Helden genug und Jauchzen und grünender Lorbeer. Tränen von Müttern geweint, schufen dies steinerne Bild.“ Der münstersche Maler Emil Stratmann zeichnete damals das Ehrenmal. Die Zeichnung fand als Postkarte in Ascheberg großen Anklang. Bevor man 1926 den Grundstein legte, musste man das erst 1913 aus großen Findlingen errichtete Denkmal abbrechen, dass an die Völkerschlacht bei Leipzig, an die Stiftung des Eisernen Kreuzes und an das silberne Regierungsjubiläum Kaiser Wilhelms II. erinnern sollte. Einige dieser Findlinge liegen da heute noch. Da das deutsche Heer – wie man damals gern sagte – wie ein Löwe gekämpft habe und im Felde unbesiegt geblieben sei, schien dieses Tier wohl das geeignete Symbol zu sein für das, was man zum Ausdruck bringen wollte. Das unbeschreibliche Leid, die furchtbaren Zerstörungen des Krieges über-stiegen ohnehin alle Möglichkeiten künstlerischer Darstellung, die man damals akzeptiert hätte. Also beschränkte man sich auf das Löwenhafte des Kämpfens und Sterbens der „Heldensöhne“, wie die Soldaten in der Gründungsurkunde genannt wurden. Diese begann mit den Worten „Deutschland über Alles“ und endete mit „Treue um Treue“. Die Einweihung des Denkmales am 15. Mai 1927 (Sonntag) begann morgens um 5 Uhr mit dem Wecken der Gemeinde durch Böllerschüsse. Um 9.30 Uhr gab es ein festliches Hochamt. Danach wurden Blumen und Karten mit dem Bild des neuen Denkmales verkauft. Nach einer kurzen Trauerandacht um 14 Uhr trafen die auswärtigen Vereine ein. Um 15 Uhr begann die eigentliche Weihe durch den Amtmann Lüffe. Der ehemalige Militärpfarrer P. Daniel Becker aus Rietberg hielt die Gedächtnisrede, und die Vereine legten Kränze nieder. Der Männergesangverein sang vierstimmig das Kriegergedächtnislied und „Deutsche Völker allesamt“. Ein Parademarsch beendete die Feier am neuen Denkmal. Dann marschierten alle zum alten Ehrenmal an der Steinfurter Straße, wo ein Trauerakt stattfand. Die Anwesenden sangen das „Niederländische Dankgebet“ („Wir treten an zum Beten vor Gott, den Gerechten“). Der Vorsitzende des Kriegervereins hielt eine Ansprache und legte einen Kranz nieder. Dann folgte ein „kameradschaftliches Beisammensein mit Konzert beim Kameraden Klaverkamp“ (Gaststätte). Die gesamte Feier stand unter der Schirmherrschaft des Generalmajors Groß, des ehemaligen Kommandeurs des 1. Westfälischen Infanterieregimentes Nummer 13 in Münster. Das Löwendenkmal fand in den fast 80 vergangenen Jahren keineswegs nur Zustimmung, aber als um 1960 von seinem Abbruch die Rede war, gab es Proteste. Damals lebten noch einige Gründungsväter, denen man das nicht antun wollte. Es gab aber auch Leute, die den patriotischen Duktus des Denkmales rundum bejahten. Alle anderen arrangierten sich mit der zeitbedingten Symbolik, und man legt bei Schützenfesten dort vor den Namen der getöteten Männer auch heute noch einen Kranz nieder. Aber kein heute Lebender hat einen von ihnen gekannt. Die letzten starben 1915. (siehe auch unter Ascheberg) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Altefeld
|
Jahrhundertelang trugen die Frauen Eimer und Kannen am Joch, auf kleinen Handwagen und schließlich im 20. Jahrhundert an den Lenkern ihrer Fahrräder in das Altefeld, um dort die Kühe zu melken. Die Altefeldstraße und die Straße Olde Feld erinnern an diese ehemalige Mark Altefeld, eine Gemeinheitsfläche, auch Allmende genannt, die sich etwa zwischen Steinfurter Straße, Pöpping, alter Herberner Straße und Emmerbach erstreckte. Sie war vorwiegend ein Weidegebiet und wurde von einer bestimmten Anzahl berechtigter Bauern und Kötter genutzt, unter denen es auch viele „kleine Leute“ aus dem Dorf gab, die nur eine Kuh besaßen und diese dort weiden ließen. Schweinehirten trieben die Schweine der Bauern und Dorfbewohner morgens ins Altefeld und abends wieder zurück in die Ställe. Um 1800 hatte sich allgemein die Meinung durchgesetzt, dass diese Art der Nutzung überholt sei, überall wurden die Allmenden aufgeteilt, und ihre Flächen den berechtigten Benutzern als Eigentum zugewiesen. Diese Teilungen fielen zeitlich mit der Aufhebung der alten Erbuntertänigkeit und Leibeigenschaft der Bauern zusammen und brachten neben der Befreiung aus der adeligen, kirchlichen und klösterlichen Vormundschaft auch eine weitgehende Umstellung des althergebrachten Wirtschaftens mit sich. Da sich rund um das Dorf ein Gürtel von Allmenden legte, die damals alle aufgeteilt wurden, fasste man sie unter dem Oberbegriff „Altefeld“ zusammen. Außer dem eigentlichen Altefeld gehörten zum Beispiel Entruper Berg, Syen, Dahl, Geismannskämpken und Kattenbrink im Süden, Mühlenflut, Rieth (oder Biet), Bispinghoverheide und Venne im Osten und Norden dazu. Die westlichen Marken wie Remberg, Erdbüschken, Könnebrack, Schliek und Landwehr wurden unter dem Namen Remberg zusammengefasst und in den Jahren 1821 bis 1826 aufgeteilt. Die Altefeldteilung wurde erst zur Jahreswende 1829/30 abgeschlossen. Angesichts der vielen in den letzten zwei Jahren zwischen Altefeldstraße und Neuer Herberner Straße entstandenen Häuser könnte man dieses Gebiet als „Neues Feld“ bezeichnen. Aber nur scherzhaft, denn in Wirklichkeit hat der Name Altefeld nichts mit alt und Alter zu tun. Da der heute so schnurgerade verlaufende Emmerbach früher in vielen Windungen und zum Teil auch weiter westlich durch das Altefeld floss, war das Gebiet zwischen dem Hof Westhues und dem östlichen Dorfrand nass und stets von Überschwemmungen bedroht, und das kam natürlich in den Flurnamen zum Ausdruck. Alfeld – ohne t – bedeutet sumpfiges Feld. Al (auch die Varianten EL,IL,OL-UL) ist ein sehr altes Wasserwort, das sich in unserem plattdeutschen Al = Jauche erhalten hat und aus dem Wort Adel entstanden ist, das natürlich nichts mit Baronen und Grafen zu tun hat. In Bayern heißt die Jauche heute noch Odel oder Adel, das Quellgebiet des Rheins ist das Adula-Gebirge, und auch bei uns gab es im Mittelalter die nach diesem Sumpfwasserwort benannte kleine Bauerschaft Edelingthorp, die später Ellentrup und dann Entrup hieß (daher der alte Name Entruper Berg). Das Land zwischen den Höfen Stiens, Frye und Lenz, alle im Altefeld, heißt auch heute noch Ölting. Dort lag vor Jahrhunderten ein Gutshof gleichen Namens, der ebenfalls das Al-Wort enthält, hier in der Variante Öl. Nach Schwieters befand sich der Hof um 1513 im Besitz des Johann von Lünen. Der von der Steinfurter Straße nach Süden abzweigende und bis zum ehemaligen Hof Pöpping (heute Krasbutter) führende Weg bekam den Namen Altefeldstraße, weil er die alte Mark Al-Feld durchquert. Da dem Gemeinderat offensichtlich an der Erhaltung dieser Flurbezeichnung gelegen war, gab er der Straße in dem Neubaugebiet dort den Namen Olde Feld, knüpfte also an die im Plattdeutschen übliche Bezeichnung Ollfell an. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Name „Hohe Lucht“
|
Die Gaststätte „Hohe Lucht“ an der Kreuzung der B 58 mit der Straße Nordkirchen-Ottmarsbocholt ist weithin bekannt, die Bedeutung ihres Namens dagegen kaum. Er kommt – besonders in Norddeutschland – oft vor, ebenso der davon abgeleitete Familiename Hohelüchter. Eine Anfrage bei den Städten mit Hohe-Lucht-Straßen und –Flurnamen ergibt, dass Lucht fast immer als Licht oder Luft, manchmal auch als Lichtung, hellfarbiger Felsen, Durchbruch der Stadtmauer oder hoch aufgehängte Beleuchtung gedeutet wird. Das auch bei uns geläufige plattdeutsche Wort Lucht kann auch Fenster oder Ausblick (Utlucht = Erker) bedeuten. Deshalb weist Schwieters vorsichtig auf die Erklärung hin. Die Städte Hamburg, Lüneburg und Celle sehen in Hohe Luft eine volkstümlich-scherzhafte Bezeichnung für einen Galgen, denn dort ist dieser Name mit ehemaligen Hinrichtungsstätten verbunden. Hohe Luft soll „hoch in der Luft“ – mit dem Hinzurichtenden nämlich – bedeutet haben. Ein Galgen ist aber bei Hohe Lucht in der Oberbauerschaft nicht nachgewiesen. Der Galgen des Gogerichtes Davensberg stand im Ascheberger Remberg an der Straße nach Nordkirchen. Oder sollte die Teilung des Gerichtes zwischen dem Bischof von Münster und den Herren auf Davensberg im 14. Jahrhundert dazu geführt haben, dass bei Hohe Lucht, in der Mitte zwischen allen Nachbarorten und gleich weit wie der Remberg von Davensberg entfernt, ein zweiter Galgen errichtet wurde? Ländliche Gasthöfe machten durch eine große Laterne auf sich aufmerksam, die sie möglichst hoch aufhängten. Das wird der Hohelüchter, der Wirt in diesem Gasthaus auch getan haben. Mit Hohe Lucht könnte auch so ein Hohes Licht gemeint sein. Da Lucht auch bewegte Luft, also Wind, bedeuten kann, galt Hohe Lucht vielleicht als windige Anhöhe. Für die Deutung spricht, dass in der Nähe am Hof Borkenfeld (heute Hölscher) eine Windmühle stand. Sie erfüllte übrigens die Bedingung, mindestens eine halbe Meile (etwa 3,7 Kilometer) von der nächsten Windmühle entfernt zu sein. Das verlangte Bischof Franz von Waldeck 1549 von Heinrich von Ascheberg zu Byink, als dieser ihn um die Erlaubnis zur Errichtung einer Mühle bei Ottmarsbocholt bat. (Ottmarsbocholt – Geschichte und Geschichten, 1982). Alle bislang genannten Erklärungen sind durchaus plausibel. Das kann man von der folgenden nicht ohne weiteres sagen, obwohl sie von der natürlichen Beschaffenheit der nächsten Umgebung ausgeht und deshalb als besonders wahrscheinlich gelten muss. Alle Kenner dieses Geländes betonen, dass es einst sehr nass war. Eine Reihe von flachen Senken und Entwässerungs-gräben, die heute verfüllt, aber noch erkennbar sind, erinnern daran, ebenso eine große Anzahl von Kopfweiden in der Nähe der Gaststätte. Auch die Namen der benachbarten Fluren Akenkamp und Essenbrok deuten auf besondere Bodennässe hin. „Hohe Lucht“ könnte auf das aus dem Altsorbischen als Lehnwort ins Niederdeutsche geratene Wort „luch“ zurückgehen, das soviel wie sumpfiges Grasland bedeutet. (Die Schlesier erinnern sich an ihr Wort „Lusche“, mit dem sie eine Pfütze bezeichneten.) Es dürfte mit dem besser bekannten Lucht verwechselt und durch dieses ersetzt worden sein. Solche volkstümlichen Umdeutungen nicht verstandener Flurnamen sind der Namenforschung in großer Zahl bekannt. Es spricht vieles dafür, dass auch hier die von der Natur vorgegebenen Boden- und Wasserverhältnisse namen-gebend gewesen sind. Mit ihnen wurden schon die ersten Ansiedler konfrontiert und alle Generationen nach ihnen, bis erst im letzten, dem 20. Jahrhundert, wirksame Entwässerungsarbeiten die nassen Böden trockenlegten. Das Adjektiv „hohe“, ursprünglich „hoge“, könnte sich auf die höhere Lage beziehen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Zollstation Schönefeldsbaum
|
Wer heute in Ascheberg, Drensteinfurt oder Rinkerode nach dem Schönefelds-baum fragt, wird kaum eine befriedigende Antwort bekommen, es sei denn, der Gefragte ist sehr alt und weiß noch aus den Erzählungen seiner Eltern, was dieser Name bedeutet. Zu lange schon, seit rund hundert Jahren, ist der Schönefeldsbaum verschwunden. Man nannte ihn volkstümlich Schobbes Baum. Er war ein alter Gasthof, verbunden mit einer Zollstation, an der Hammer Chaussee, wie die heutige Bundesstraße 54 südlich von Münster früher genannt wurde, rund 400 Meter nördlich der Gaststätte Schwatten Holtkamp. Die Landwehr an der Grenze von Rinkerode, Drensteinfurt und Ascheberg kreuzte hier diese wichtige Straße von Münster nach Hamm-Arnsberg und Dortmund-Köln. Hier war der Schlagbaum am Schönefeld, und von dem hatte der Gasthof seinen Namen erhalten. Zu den letzten Gästen des Schönfeldsbaum gehörte wohl der Ascheberger Landwirt und Ziegelbrenner Anton Weber. Als er im Jahre 1936 seinen 82. Geburtstag feierte, fragte ihn der Reporter der Lokalzeitung nach seinen Kindheits- und Jugenderlebnissen. Der alte Herr erzählte mit Vergnügen und auf Platt von Schule und Beruf und überraschte seine Zuhörer mit der Feststellung, er habe als junger Kerl, so um 1875, gern Karneval gefeiert, am liebsten in Schobbes Boom. Dort habe man mit Freunden ein Fässchen Bier aufgelegt und seinen Spaß gehabt. Leider sei der Gasthof mit allen Gebäuden schon lange verschwunden, bis auf den alten Hausbrunnen, der noch einsam mitten im Acker stehe. Scheers Pütt werde er genannt, weil der letzte Wirt im Schönefeldsbaum Werner Scheer geheißen habe. Er hatte die Witwe Elisabeth Schönefeldsbäumer geheiratet und war als fideler Kumpan bei allen Gästen beliebt. Diese Eigenschaft sei aber – so meinten die Leute – dem Betrieb nicht all zu gut bekommen, und wirtschaftliche Schwierigkeiten hätten nicht lange auf sich warten lassen. Der Schönefeldsbaum lag an einer wichtigen Stelle im alten münsterländischen Straßennetz. Wenige Meter südlich trennte sich die Köln-Dortmunder-Chaussee von der nach Hamm-Werl-Arnsberg. So kamen aus drei Richtungen Fuhrleute und Reisende aller Art dort zusammen. Viele preußische Offiziere aus der Garnison Münster stiegen im Schönefeldsbaum ab, und wenn sie auch ihre Zeche nicht immer gleich bezahlten, so verliehen sie doch dem alten Gasthof einen gewissen Glanz. Auch die Vertreter der Königlichen Regierung zu Münster verschmähten ihn nicht, als sie 1851 beim Verkauf der benachbarten Domäne Holthoff die Kaufverträge im Schönefeldsbaum unterzeichneten und ihn ausdrücklich als Ort der Verträge nannten. Der Schönefeldsbaum war mehr als ein Pferdekotten, als den ihn die Hausstättenschatzung des Amtes Wolbeck 1665 bezeichnete. Jedoch waren nicht alle Gäste dort von feinster Art. Und die üble Tour zweier Kartenspieler, die ihren soeben gewonnenen dritten Mann auf die Eckbank unter einen schräg aufgehängten Spiegel setzten, um dem Ahnungslosen ins Blatt schauen zu können, wurde noch weitererzählt, als die bösen Buben schon längst der grüne Rasen deckte. Die Gasthäuser an den Kirchplätzen in Ascheberg, Rinkerode und Drensteinfurt hatten solidere Gäste, aber sie waren ja auch nicht der Schönefeldsbaum, der zugleich ein Zollhaus war, was sogar die Rinkeroder Kirchenglocken wussten. Sie riefen nämlich, verständlich für jeden, der es verstehen wollte, die Nachbarschaft im südlichen Zipfel der Rinkeroder Bauerschaft Eickenbeck zusammen: „Guhierg, Milt un Pankok, de gaoht tehaup nao`t Tollhus!“ Das heißt: Die Nachbarn Gudehege (heute Lackenberg), Milte (Allendorf) und Pankok, die gehen zusammen zum Zollhaus. Andere hörten: „Uese Gais un Miltens Gais, de gaoht tehaup nao`t Tollhus!“ (Unsere Gänse und Miltes Gänse, die gehen zusammen zum Zollhaus.) Wahrscheinlich konnte man diese Glockensprache nirgends so gut verstehen wie im Schönefeldsbaum, wo sie vermutlich auch zuerst formuliert worden ist. Wie sonst wäre das Zollhaus und die Nachbarschaft zu solchen Ehren gekommen? Übrigens war man in Rinkerode mehr der Ansicht, die Glocken riefen: „Krurp, Diänter un Korbaum“, also: Krurup, Deventer und Karbaum – drei Höfe in der Nähe des Dorfes. Welche Sprache richtig ist, bleibt ungeklärt, denn die Weltkriege haben alle Glocken verschlungen, roh und ohne Gefühl für feine Töne. Der Schönefeldsbaum muss sehr alt gewesen sein, der Name noch älter als der Gasthof. Domus Sconevelde hieß im 13. Jahrhundert dort ein Hof, dessen genaue Lage nicht bekannt ist. Scone ist einer der vielen uralten Namen, die auf ein sumpfiges Gelände hindeuten. Das Wort ist verwandt mit dem griechischen Wort Schoinos, was Binse, also eine Sumpfpflanze, bedeutet. Schönefelds Holz heißt der ganze Bereich entlang der Straße in Richtung Herbern bis ins Ascheberger Gebiet hinein. Der Name war im neunzehnten Jahrhundert in allen Nachbarorten bekannt. Als die Kreisstraße von Ascheberg in Richtung Drensteinfurt ausgebaut werden sollte, war beim Lüdinghauser Landratsamt nur von der Straße „Ascheberg – Schönefelds Holz“ die Rede. Wahrscheinlich schon im Mittelalter, sicher aber noch im 17. Jahrhundert, spielte der Gasthof als vierte Station der Ascheberger Katharinenprozession eine große Rolle. Die Ascheberger zogen am Sonntag nach Jacobi (25. Juli) in einer riesigen, leider wenig ordentlichen Prozession mit dem Standbild der heiligen Katharina von Alexandrien an den Grenzen ihres Kirchspiels entlang, nach Art der alten Schnatgänge. Tausende aus allen Nachbarorten liefen mit, vom Samstagabend gegen Mitternacht bis zum Sonntagmittag, über Äcker und durch Wälder und bei jedem Wetter. Die erste Station war beim Hof Willermann in der Westerbauerschaft, die zweite beim Hof Stummann-Rohlmann in der Ottmarsbocholter Oberbauerschaft, die dritte vor der Burg in Davensberg und die vierte am Schönefeldsbaum. An allen Stationen waren Gottesdienste vorgesehen, aber daraus wurde nicht viel. Eine müde, teils alkoholisierte Menge mit unruhigen Pferden – die nahm man auf dem ganzen Weg mit – waren an der vierten Station nur noch an der Gaststätte interessiert. Vielleicht freute sich der Wirt Schönefeldsbäumer über das lebhafte Geschäft, vielleicht aber sah er dem zu erwartenden Durcheinander mit Unbehagen entgegen, sicher aber stand er bei den Pfarrern in Ascheberg, Drensteinfurt und Rinkerode nicht in hohem Ansehen. Pfarrer Wennemar Uhrwercker in Ascheberg griff durch, bat den Bischof von Münster um ein Verbot der Prozession und erreichte, dass sie ab 1653 sehr verkürzt und ordentlich ihren Weg ging. Den Schönefeldsbaum berührte sie nun nicht mehr. Um 1905 stellte der Gasthof seinen Betrieb ein, die Grundstücke wurden verkauft, die Gebäude abgebrochen. Wo Werner Scheer, der letzte Wirt, geblieben ist, wissen wir nicht. Der oben erwähnte Brunnen Scheers Püttdiente bis zum Sommer 1989, als der Besitzer ihn entfernte, noch als Viehtränke. Was ist geblieben? Nur die Landwehr ist an einigen Stellen erhalten, aber im Bereich des ehemaligen Gasthofs ist auch sie verschwunden. Auch die Grenzen des Hofgeländes sind noch erkennbar. Es liegt südlich des Weges zur Schreinerei Beckamp und zum Hof Höckesfeld. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Ostereckern
|
Südlich der Bundesstraße 58 und parallel zu ihr verläuft in der Osterbauerschaft der Wirtschaftsweg „Ostereckern“. Sein Nutzen für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Radfahrer ist unbestritten und allgemein anerkannt, nicht so sehr aber sein Name, wenngleich man sich im Lauf seines Bestehens allmählich an ihn gewöhnt hat. Er ist ein künstliches Gebilde aus der Silbe „Oster“ des Wortes „Osterbauerschaft“ und dem Namen „Eckern“, der ein Flurstück am östlichen Teil des Weges bezeichnet. Nicht zuletzt deswegen blieb er den Anwohnern und Nachbarn fremd und unvertraut. Die Ähnlichkeit mit dem hochdeutschen Plural „Äcker“ hat sicher zusätzlich zu Missverständ-nissen geführt. Denn wo sich ein Acker an den anderen reiht, kann „Eckern“ – ob mit Ä oder E geschrieben – kein unterscheidender Name sein. „Up´n Eckern“ und „Eckernbuschk“ sind alte Namen für einen Acker und einen Wald, beide Eigentum des Landwirts Ludger Bollermann, zwischen den Höfen Fallenberg und Ostermann-Schulze Frenking am Baikingweg gelegen. Eine besondere Bedeutung für die Nachbarschaft hatte und hat diese Flur nicht. Natürlich wissen die Landwirte in diesem Teil der Osterbauerschaft, dass „Up`n Eckern“ schon immer ein sehr nasses Stück Land war und einiges an Bodenverbesserungsarbeit erforderte. Es wird an zwei Seiten zu einem Graben hin entwässert und liegt auffällig niedrig, was leicht zu erkennen ist, wenn man sich mit dem Fahrrad nähert. Nördlich des Eckernbusches wächst Schilf und Sumpfgras, und in den Ackerfurchen steht Wasser, auch wenn es nicht geregnet hat. Tatsächlich ist das Wort Eckern gleichbedeutend mit Ak und Ach und mit dem lateinischen Wort „aqua“ (= Wasser) verwandt. Es gibt in Deutschland viele Namen dieser Art: Eckbach, Ecker, Eckweiler, Eckstedt, Eckernförde, Ecknach – alles Namen mit der Grundbedeutung „Wasser“. „Up`n Eckern“ ist ein sehr altertümliches Wort, das, unverstanden und wohl auch wenig verändert, Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende überstanden hat. Es wurde nicht verformt durch Umdeutung in einen anderen Sinnzusammenhang, wie das z. B. in der benachbarten Rinkeroder Bauerschaft Eickenbeck geschehen ist, die im Werdener Urbar um 890 „Ekasbeki“ hieß. „Eksbierk“ nennt man sie heute noch auf Platt. Bei der Verhochdeutschung wurde daraus „Eickenbeck“, weil man das „Ek“ als „Eeken“ (Eichen) deutete. Das alte Wasserwort Ek wurde nicht mehr erkannt. Der Drensteinfurter Bauerschaft „Eickendorf“ dürfte es ähnlich ergangen sein. „Up`n Eckern“ ist kein Bauerschaftsname gewesen und eine Angleichung an das Hochdeutsche war nie erforderlich, weil kein „öffentliches Interesse“ daran bestand. So blieb der alte Name erhalten. Die Ähnlichkeit mit dem Wort „Bucheckern“ hat zu der irrigen Deutung geführt, „Eckern“ sei ein Buchenwald gewesen, und die Bucheckern hätten der Flur den Namen gegeben. Von Buchenwäldern sei ja auch der benachbarte Hofname Beuckmann = Böckmann = Buchenmann, also Anwohner am Buchenwald, abzuleiten. Das letzte soll nicht bestritten werden, aber die Bucheckern-These ist nicht zu halten, denn sie entspringt heutigen Vorstellungen. Die alten, uns so unverständlichen Lokalnamen beziehen sich alle auf die Bodennatur, insbesondere die Wasserverhältnisse, denn diese waren bei der ersten Besiedlung und Bearbeitung des Landes von so großer Bedeutung, dass sie namengebend wurden. In unserem Fall ist es besonders günstig, dass die ursprünglichen Wasserverhältnisse wenigstens noch in Resten erkennbar sind. So erinnert uns der Name „Eckern“ an ein landwirtschaftliches Problem, das bis in unsere Tage hinein wirksam geblieben ist: die nassen und sauren Böden. wenn auch Melioration und moderne Düngemittel Abhilfe gebracht haben. Darüber hinaus kann er uns auch an die harte und fast hoffnungslos erscheinende Arbeit unserer Vorfahren erinnern: Alles in allem: ein Name, den man trotz seiner Künstlichkeit schätzen kann. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Bernhard Heinrich Neuhaus, Amtmann von Ascheberg
|
Von den acht Amtmännern, die zwischen 1815 und 1945 Ascheberg verwalteten, kam einer mit der staatlichen Gewalt so sehr in Konflikt, dass er sein Amt verlor, nämlich Bernhard Heinrich Neuhaus, Amtmann von 1867 bis 1876. Er kam am 17. März 1833 in Datteln als Sohn des Gastwirts Engelbert Neuhaus und dessen Frau Maria Neuhaus, geb. Hünewinkel, zur Welt. Seine Schulleistun-gen waren so gut, dass der Lehrer Luthe in Datteln ihm durch zusätzlichen Privatunterricht die Aufnahme in das Lehrerseminar in Büren ermöglichte. 1854 bestand er die Lehrerprüfung und wurde Privatlehrer im Hause des Amtmanns Brüning in Enniger. |
 |
|
Dieser hatte nur einen Sohn, und Neuhaus daher mehr Freizeit als seine Kollegen an den regulären Schulen. Amtmann Brüning übertrug ihm deshalb Verwaltungsarbeiten in seiner Schreibstube in Enniger. Ab 1857 war er dort nur noch Amtssekretär. Als der Bürgermeister von Sendenhorst beurlaubt war, übernahm Neuhaus auch dort vertretungsweise die Amtsgeschäfte. Der Königliche Landrat Graf von Schmiesing-Kerßenbrock in Beckum war mit Neuhaus' Arbeit sehr zufrieden und brachte das auch in einem Brief vom 2.11.1863 an die Königliche Regierung zum Ausdruck. Als Neuhaus sich 1867 um die Amtmannsstelle in Ascheberg bewarb, hatte er gute Chancen. Der Lüdinghauser Landrat von Landsberg schickte ihm am 29.10.1867 die Ernennung zum kommissarischen Amtmann in Ascheberg nach Enniger, wo Neuhaus noch wohnte. Am 2. August 1869 wurde er endgültig angestellt. Neuhaus war ein engagierter Katholik und wurde bald Mitglied des Katholischen Vereins in Lüdinghausen, der den Zweck verfolgte, katholische Männer "zur Besprechung und Wahrung der katholische Interessen auf geselliger Grundlage zu verbinden". Ein solcher Verein musste damals, als Bismarck den Kulturkampf gegen die katholische Kirche führte, auf Misstrauen stoßen, und Amtmann Neuhaus erhielt wie auch sein Nordkirchener Kollege Fischer die Aufforderung des Regierungspräsidenten, aus dem Verein auszutreten. Er sei von Amts wegen Ortspolizeibehörde und könne daher als Mitglied des Katholischen Vereins in Konflikte geraten. Als er und Fischer sich dagegen wehrten, schloss der Regierungspräsident sie 1872 zwangsweise aus dem Verein aus. Neuhaus protestierte vergeblich beim Oberpräsidenten von Westfalen, beim Innenminister in Berlin und schließlich beim Petitionsausschuß des Preußischen Landtags. 1875 beschlagnahmte die Regierung das Vermögen der Ascheberger Vikarie wegen angeblicher Unkorrektheiten in der Buchführung und übertrug die Verwaltung Amtmann Neuhaus. Dieser lehnte ab. Er könne diese Aufgaben nicht übernehmen, "ohne gegen die Vorschriften der katholischen Kirche großen Anstoß zu geben und mich mit meinen eigenen religiösen Ansichten in großen Widerspruch zu setzen". Diese Haltung führte zu seiner Entlassung aus dem Amt. Neuhaus versuchte wieder, durch Proteste bei den vorgesetzten Behörden und beim Abgeordnetenhaus, zu seinem Recht zu kommen. Aber auch diesmal erreichte er nichts. Er trat dann als Rentmeister in den Dienst des Grafen von Fürstenberg-Herdringen, dessen Vorfahren im 18. Jh. den Besitz der Freiherrn von Ascheberg-Ichterloh erworben hatten. Eine besondere Ehrung erfuhr Neuhaus, als Landrat von Landsberg ihn 1879 bat, für den Preußischen Landtag zu kandidieren. Er lehnte aus gesundheitlichen Gründen ab. Bis zu seinem Tod am 10. Mai 1912 war er stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Er förderte den Bau des Krankenhauses durch Schenkung eines Grundstücks und erbaute für sich und seine Frau Anna Julia Breymann (1838 - 1904) aus Ascheberg, die er 1870 geheiratet hatte, das große Wohnhaus neben der Post auf der Sandstraße, das heute der Familie Egon Bolte gehört. Da er keine Kinder hinterließ, verfügte er in seinem Testament vom 28. Januar 1911 den Verkauf seines Hauses und die Verteilung des Erlöses an eine Reihe von Verwandten. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Schulgebäude in Ascheberg
|
Es gab noch kein eigenes Schulhaus, als der Ascheberger Küster Johann Hölscher um 1600 die Kinder unterrichtete. Sie kamen zu ihm in die Wohnung, denn es waren nur wenige. Erst als die Gutsherren im Kirchspiel Ascheberg – Christoph Bernhard von Galen, Ferdinand von Morrien, Johann Conrad von Wulff und Johann Heinrich von Ascheberg - 1649 dem Vorschlag des Pfarrers Wennemar Uhrwercker, eine Schule einzurichten, zustimmten, musste ein eigenes Schulhaus gebaut werden. |
 |
|
Johann Heinrich und Elberika von Ascheberg zu Ichterloh stifteten 1649 das erste Schulgebäude in ihrem Speicher an der Kirche. Er stand nicht direkt am Kirchplatz, sondern etwas weiter südlich, etwa zwischen dem heutigen Verkehrsverein und der Brunnen-Apotheke. Eine schmale Gasse zwischen den Speichern von Schulze Steinhorst und Lütke Steinhorst – es sind heute die beiden Fachwerkhäuser westlich des Pfarrhauses neben dem Weg zum Katharinenplatz- führte zum Schulhaus. Auch das heute mit der Traufe zum Kirchplatz stehende breite Haus bestand damals aus zwei giebelständigen Speichern. Falls die Gasse zwischen ihnen schon so schmal war wie heute, versteht man, dass die Schulkinder zuweilen für Ärger bei den Nachbarn sorgten. Das war wohl auch später einer der Gründe für einen Neubau an der Himmelstrasse. Aber rund 170 Jahre diente der Ichterloh-Speicher als Schulhaus. 1825 reichte dieser Raum nicht mehr für alle Kinder, und man trennte die Jungen und Mädchen, indem man im Garten des Lehrerhauses an der Sandstrasse eine Jungenschule errichtete. Dieses Lehrerhaus war ursprünglich 1652 von dem Freiherren von Ascheberg-Ichterloh gestiftet worden. (Heute gehört es der Familie Raters, die es 1992 renoviert hat.) Die gemischten Unter- und Mittelklassen blieben im alten Haus am Kirchplatz, wahrscheinlich noch rund 20 Jahre, denn 1847 baute man an der Himmelstrasse ein drittes Schulhaus. |
|
Das war zwar massiv gebaut, lag aber viel zu niedrig. Der Fußboden der Räume im Erdgeschoss blieb unter dem Niveau der Strasse. Dafür war der Dachraum riesig. In diesem Haus waren auch das kommunale Armenhaus und die Dienstwohnungen des zweiten Lehrers und der Lehrerin untergebracht. 1873 wurde die Schule an der Dieningstrasse (gegenüber von Nientidt und Heitmann) eröffnet. Sie wurde 1965 abgebrochen. An ihrer Stelle steht heute ein modernes Gebäude, in dem bis 1996 die Sparkasse war. |
 |
 |
Auch das Schulhaus an der Himmelstrasse entsprach 1907, also nach rund 60 Jahren, nicht mehr den Anforderungen. Man brach es ab und erbaute dort eine zweigeschossige Schule mit Dienstwohnungen. Heute befindet sich an ihrer Stelle der Parkplatz der Volksbank, denn sie wurde 1975 im Zuge der Ortskernsanierung abgebrochen. Von 1908 bis 1936 hatte das Dorf drei Schulgebäude: an der Sandstrasse das alte von 1825, an der Dieningstrasse das etwas jüngere von 1873 und an der Himmelstrasse das jüngste von 1907/08. |
|
Um 1930 war die Schule für die großen Jungen an der Sandstrasse zu klein geworden – man nannte sie übrigens „Otte-Schule“, weil hier Rektor Anton Otte unterrichtete, der auch im angrenzenden Lehrerhaus wohnte – und ein neues Schulhaus mit fünf Klassenräumen war 1936 an der heutigen Albert-Koch-Strasse bezugsfertig. Es wurde am 5. Juni 1936 eingeweiht, gleich zweimal, zuerst vom Pfarrer, danach vom Schulrat, der seinen Vertreter schickte, einen Nazi, der sehr verärgert war, als er bemerkte, dass der Pastor ihm zuvorgekommen war. Er kannte die katholischen Gewohnheiten in solchen Fällen nicht: zuerst die Messe und der Segen des Pfarrers, dann die weltliche Feier mit den Behördenvertretern. Diese Schule steht heute noch, ebenso das Lehrerhaus, das aber 1976 verkauft wurde an zwei Lehrer, die darin wohnen blieben. 1936 war eine Dienstwohnung für den Schulleiter an der Herberner Straße geplant, die aber wegen des Hitlerkrieges nicht gebaut wurde. Auch die neue Schule von 1936 musste erweitert werden, zuerst 1957 durch einen separaten Neubau südlich daneben, der durch eine Pausenhalle mit der „alten“ Schule verbunden war. 1994/95 wurde auf diese ein Obergeschoss gesetzt, und 2002 kamen noch drei Klassenräume im ehemaligen Hausmeistergarten an der Ostseite hinzu. Aber zwischen 1957 und 1994 hatte man an den Bau von 1957 ein Stück angebaut und zusätzlich noch Klassenpavillons aufgestellt, die aber dann dem Neubau weichen mussten. Die Schule an der Dieningstrasse wurde zur Realschule, bis diese 1963 einen Neubau am Bahnhofsweg beziehen konnte. Das Gebäude an der Himmelstraße beherbergte von 1947 bis 1967 die einklassige evangelische Volksschule, diente dann, als die Gemeinschaftshauptschule an der Albert-Koch-Strasse eingeführt war, der neuen Grundschule. |
|
Diese konnte 1971 an die Albert-Koch-Strasse ziehen, weil die Hauptschule neben der Realschule am Bahnhofsweg einen Neubau erhielt. 1989 wurde die Hauptschule mit der in Herbern zusammengelegt, und ihr Gebäude zum Haus 2 der Realschule. Zugegeben, die Verhältnisse sind nur für die Zeitzeugen durchschaubar, alle anderen dürfen den Kopf schütteln oder sich anhand von Notizen ernsthaft mit dem Ascheberger Schulwesen befassen. |
 |
|
Die namenlose Schule an der Albert-Koch-Strasse erhielt 1957 den Namen Michael-Schule und eine große Michael-Statue aus der Werkstatt des angesehenen Bildhauers Heinrich Gerhard Bücker-Vellern wurde 1960 angeschafft. Das alles beschloss der Gemeinderat, unterließ es aber, den Beschluss korrekt zu protokollieren. Deshalb kamen später an der Rechtmäßigkeit der Namengebung Zweifel auf. Eltern und Lehrer beschlossen im Jahre 2002, die Schule umzutaufen in „Lambertus-Grundschule Ascheberg“. Man hatte die Ascheberger um Vorschläge für einen neuen Namen gebeten, aber für keinen Vorschlag gab es eine Mehrheit, so dass man sich zuletzt auf den Namen des Kirchenpatrons einigte. Der Gemeinderat stimmte zu. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Jule Siebeneck
|
Als der vor einigen Jahren in hohem Alter verstorbene münstersche Sänger, Maler und Dichter Tönne Vormann als junger Mann in München seines Reisegepäcks beraubt und ziemlich mittellos im Bahnhofswartesaal übernachten musste, schrieb er nachts ein Drehbuch für einen Stummfilm, dem er den Titel "Die Dorfjule" gab. Ein amerikanischer Produzent kaufte es ihm tatsächlich ab, und Vormann erhielt ein beachtliches Honorar und eine Anstellung bei einer Filmgesellschaft. Tönne Vormanns Mutter Elisabeth Mersmann stammte von der Sandstraße in Ascheberg, und die älteren Ascheberger, die in den zwanziger Jahren schon Schulkinder waren, erinnert der genannte Filmtitel an eine alte Frau, die damals jedes Kind kannte: die alte Jule am Kirchplatz. Auch Tönne Vormann hatte sie kennengelernt, wenn er seine Verwandten in Ascheberg besuchte. Sie war auch gar nicht zu übersehen, denn sie stand gewöhnlich hinter der Tennentür ihres kleinen Fachwerkhauses, lehnte sich auf den unteren Teil der quergeteilten Tür und beobachtete das Publikum auf dem Kirchplatz und besonders die großen Jungen der benachbarten Schule. Ihr Haus stand dort, wo sich heute der neue Anbau der Gaststätte Burghof befindet und die Schule an der Stelle der ehemaligen Sparkasse. Es war bei den Ascheberger Schulkindern üblich, die Jule bei jeder Gelegenheit durch freche Zurufe zu ärgern. Sie drohte und schimpfte zurück und rächte sich, indem sie die vor ihre Tür rollenden Spielbälle nicht zurückgab. Die alte Jule war damals Mitte sechzig, aber das Wörtchen "alt" war verächtlich gemeint. Dabei bestand eigentlich kein Anlass, die Frau geringzuschätzen. |
 |
|
Sie war eine geborene Forsthove, verwitwete Braumann und seit 1889 mit dem angesehenen Kunstschreinermeister und Drechsler Hermann Siebeneck verheiratet, der mit seinem Bruder Heinrich, der ebenfalls Schreinermeister war, von allen bewunderte Arbeiten geschaffen hatte, z.B. die Chorstühle, die Kanzel und die Beichtstühle in der Ascheberger Kirche. Ihr richtiger Name war Julia, sie war 1857 geboren und 24 Jahre jünger als ihr Mann, der 1915 starb. Warum sie sich stets verärgert und aggressiv zeigte, ist nicht bekannt, aber auch die Erwachsenen hatten ihre Last mit dieser schwierigen Frau. Tönne Vormann schilderte seine Film-Jule als eine Hexe, die mit allerlei Gesindel Umgang hatte und magisch begabt war. Das allerdings traf auf Julia Siebeneck nicht im Mindesten zu. Sie war eine unbescholtene Frau, führte ihren Haushalt ordentlich und besuchte mit ihrem greisen Ehemann - er war 1833 geboren - auch sonntags die Gottesdienste. Dabei war sie nicht zimperlich und wies ihn vor allen Leuten energisch zurecht, wenn ihr das nötig erschien, und das scheint oft der Fall gewesen zu sein. Julia und Hermann Siebeneck hatten keine Kinder, der um sechs Jahre jüngere Bruder Heinrich und seine Frau Anna Stratmann aus Herbern dagegen vier Mädchen und einen Jungen, der schon mit drei Monaten starb. Sie sind also keine Vorfahren der heutigen Familie Siebeneck. Julia Siebeneck starb am 27. Juni 1931, 74 Jahre alt. Ihr Haus, das der Familie Forsthoff im "Burghof" gehörte und nicht verwechselt werden darf mit dem kleinen, erst bei der Ortskernsanierung in den siebziger Jahren abgebrochenen Mietshaus, verschwand bald darauf. Es war, wie sich ältere Leute erinnern, sehr alt und nicht erhaltenswert. Mit ihm verging die Erinnerung an eine wunderliche und aus uns nicht mehr bekannten Gründen wenig geachtete Frau, die mit stiller Billigung durch die Erwachsenen zum Gespött der Kinder geworden war. Es verschwand auch die Schreinerwerkstatt, in der Hermann und Heinrich Siebeneck nach den Plänen des aus Ascheberg stammenden Bildhauers Anton Rüller beachtliche Kunstwerke im neugotischen Stil geschaffen hatten. "Siebeneck fecit" (Siebeneck hat es hergestellt) schrieben sie in unverstandenem Latein, aber gewiss nicht ohne Stolz auf die Rückseiten. (siehe auch dazu ein Gedicht von Bernhard Bergmann: Dat Julchen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Landwirtschaftliche Winterschule Ascheberg
|
Am 4. November 1907 eröffnete die Landwirtschaftliche Winterschule im Ascheberger Katharinenstift ihre Pforten. 39 Schüler hatten sich in das neue Institut eingeschrieben. Das Haus war erst 1903/04 von der katholischen Kirchengemeinde erbaut worden, um eine Haushaltungsschule, einen Kindergarten und Altersheim aufzunehmen, aber der am Bildungs- und Schulwesen in Ascheberg sehr interessierte und immer innovationsfreudige Pfarrer Joseph Degener drängte die Gemeinde, dort auch eine Winterschule für die Jungbauern einzurichten. |
 |
|
Die politische Gemeinde war bereit, die neue Schule auf ihren Etat zu übernehmen. Das erwies sich aber schon 1910 als zu teuer für Ascheberg, und der Kreis Lüdinghausen wurde Träger der Schule. Sie war eine Winterschule, denn nur in dem von Feldarbeit freien Winterhalbjahr konnten die jungen Bauern an einen Schulbesuch denken. Der erste Schuldirektor war von 1907 bis 1912 der aus Herbern stammende und bislang in Hohenwestedt, Holstein, tätige Landwirtschaftslehrer Wilhelm Tillmann. Das Internat der Schule, ebenfalls im Katharinenstift, wurde geleitet von dem geistlichen Rektor August Konermann. In den Jahren 1911/1912 reichten die Räume nicht mehr, und die Kirchenge-meinde baute neben das Katharinenstift die Landwirtschaftsschule. Direktor Tillmann verließ 1912 die Schule und wurde Schulleiter in Münster. Er war der Gründungsdirektor, und damals war man sich in Ascheberg einig, dass man diesem Mann viel verdanke und dass er sich um die berufliche Bildung der Landwirte große Verdienste erwoben habe. Anfangs erteilte Tillmann den Unterricht in allen Fächern allein. Später kamen zwei bis drei Lehrer, in der Regel nur für ein Wintersemester eingestellt, hinzu. 1908 unterrichteten Rektor Konermann in Religion und den Elementarfächern, Tierarzt Tillmann in Tierheilkunde und Pfarrer Wigger, Capelle, in Zoologie. Die Schule unterstand einem Kuratorium, das 1908 aus folgenden Herren bestand:  1. Ignatz Freiherr von Landsberg, Drensteinfurt, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen 1. Ignatz Freiherr von Landsberg, Drensteinfurt, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westfalen 2. Graf von Westphalen, Königlicher Landrat, Lüdinghausen, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins, Lüdinghausen 2. Graf von Westphalen, Königlicher Landrat, Lüdinghausen, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisvereins, Lüdinghausen 3. Amtmann Friedrich Press, Ascheberg, Vorsitzender des Kuratoriums 3. Amtmann Friedrich Press, Ascheberg, Vorsitzender des Kuratoriums  4. Pfarrer Degener, Ascheberg 4. Pfarrer Degener, Ascheberg  5. Gutsbesitzer Greiwe, Ascheberg, Ortsvorsteher 5. Gutsbesitzer Greiwe, Ascheberg, Ortsvorsteher  6. Gutsbesitzer Schulze Hobbeling, Davensberg 6. Gutsbesitzer Schulze Hobbeling, Davensberg  7. Schulleiter Tillmann, Ascheberg 7. Schulleiter Tillmann, AschebergEs kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass Pfarrer Degener in allen Angelegenheiten, die über den Fachunterricht hinausgingen, die Hauptrolle spielte. Er hatte als junger Kaplan Bismarcks Kulturkampf erlebt und deswegen allerlei Nachteile ertragen müssen und setzte nun alles daran, katholisches Denken in allen Bereichen der Bildung wirksam werden zu lassen. Er war Erzieher in der Familie des Fürsten von Isenburg-Birstein gewesen und daher den Umgang mit dem in der Kaiserzeit noch sehr einflussreichen Adel gewohnt. Er dürfte also im Kuratorium wenig Scheu gezeigt haben. Die zweisemestrige Schule schloss das Halbjahr alljährlich ab mit der öffentlichen Abschlussprüfung im März. Sie gab dazu einen Jahresbericht heraus, der ausführlich über das Schulleben informierte. Die erste Abschlussprüfung fand am 27. März 1908 statt. Als Gäste nahmen daran teil Landrat Graf Westphalen, Kreisschulinspektor Herold, die Geistlichen aus Ascheberg und Herbern, Kuratoriumsmitglieder, Eltern der Schüler und weitere Interessenten. Die Prüfungen dauerten von 9 bis gegen 13 Uhr, und dass die Jungen vor diesem Auditorium bestehen konnten, zeigt, wie sicher sie sich ihrer Leistungen sein mussten. Die Schüler erhielten ihre Zeugnisse, waren nun staatlich geprüfte Landwirte und künftig nicht mehr auf die mehr oder weniger qualifizierten Ratschläge angewiesen, die die älteren Nachbarn beim Bier nach dem sonntäglichen Hochamt austeilten. Die Schüler des ersten Semesters wurden vom Schulleiter dringend gebeten, im Herbst zum Abschluss-Semester wiederzukommen. Das taten sie in der Regel auch. Nach dem Schülerverzeichnis des Jahresberichtes 1908/09 besuchten 48 Jungen die Schule, davon sieben aus Ascheberg: Heinrich Bose, Heinrich Geismann, Karl Beuckmann, Hugo Entrup, Adolf Holtschulte, Josef Kortenbusch und Josef Wintrup, der 37 Jahre später mit seinem Nachbarn Dr. Pistorius am Karfreitag 1945 den einrückenden Amerikanern mit der weißen Fahne entgegenging und ihnen sagte, dass kein deutscher Widerstand zu erwarten sei. Angesichts der damals noch großen Anzahl von Bauern in Ascheberg waren die sieben Schüler eine Minderheit. Das Schulgeld betrug für ein Semester 30 Mark. Vielleicht war das doch für manche Eltern zu teuer, vielleicht spielte auch ein gewisses Misstrauen gegen „Schul- und Bücherweisheit“ noch eine Rolle. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Ascheberger Bild der Katharina von Alexandrien
|
An der Südwand der Kirche, innen, vorn rechts, steht auf einer barocken Konsole eine Statue der heiligen Katharina von Alexandrien, deren Namenstag am 25. November gefeiert wird. Sie stand nicht immer hier. Ihr ursprünglicher Platz war die Nische neben dem Chorbogen, in der seit einigen Jahren eine Muttergottesfigur zu sehen ist. Wer sich an die alte Einrichtung der Kirche vor 1968 erinnert, weiß, dass zwischen der Nische und der Südwand ein Seitenaltar mit den Figuren der heiligen Barbara, Apollonia und Katharina stand. Es gab also dicht nebeneinander zwei Katharinenstatuen, die eine in der Nische, die andere auf dem Seitenaltar, der deswegen Katharinenaltar genannt wurde. Es war früher üblich, am Kirmessonntag auf dem Tisch dieses Altars die sogenannten Katharinenpyramiden aufzustellen. Das waren acht turmspitzen-förmige, mit rotem Stoff bespannte Holzpyramiden, einige dreieckig, einige quadratisch, auf denen eine große Anzahl von silbernen und goldenen Medaillen, Kreuzchen, Ringen und Kettchen angenäht war, daneben auch silberne Beine, Arme und Herzen – alles Votivgaben, die fromme Menschen einst zu Ehren der heiligen Katharina gestiftet haben, um durch ihre Fürbitte von Krankheiten geheilt zu werden. Eigentlich standen sie auf dem Altartisch des um 1880 errichteten neugotischen Katharinenaltars an der falschen Stelle, denn die Verehrung galt zwar der Heiligen Katharina, aber die Augen der frommen Beter waren weniger auf die prächtige neugotische Gestalt der Heiligen in der Mitte des Altars gerichtet, als auf die kleinere und bescheidenere Figur in der Nische. Denn alle wussten damals, dass sie die ältere und ehrwürdigere, wenn auch nicht elegantere war. Ihr waren ebenfalls alle Votivgaben gespendet worden, und ihr spendete man weiterhin manchen Taler und manche Mark. |
 |
|
Eigentlich standen sie auf dem Altartisch des um 1880 errichteten neugotischen Katharinenaltars an der falschen Stelle, denn die Verehrung galt zwar der Heiligen Katharina, aber die Augen der frommen Beter waren weniger auf die prächtige neugotische Gestalt der Heiligen in der Mitte des Altars gerichtet, als auf die kleinere und bescheidenere Figur in der Nische. Denn alle wussten damals, dass sie die ältere und ehrwürdigere, wenn auch nicht elegantere war. Ihr waren ebenfalls alle Votivgaben gespendet worden, und ihr spendete man weiterhin manchen Taler und manche Mark. Die Kerzen rechts und links der Nische verloschen selten, und an den Krallen der vier Leuchter hingen immer wieder Büschel von Flachs, solange Flachs noch als Opfergabe gelten konnte. Katharinenopfer gab es zu allen Zeiten reichlich. Keine Kirchenvorstandssitzung begann damals ohne die Überprüfung der eingegangenen Katharinenopfergaben und Zählung der Geldspenden. Schon 1483 hatte man die Verteilung dieser Gaben zwischen Pfarrer und Gemeindevertretern vertraglich regeln müssen. Das wirkliche Alter der Statue in der Nische kannte auch früher niemand. Man nahm lediglich an, dass sie zwei oder zweieinhalb Jahrhunderte in der Kirche stand, doch wusste man genau, dass sie alljährlich am Sonntag nach Jakobi (25. Juli) inmitten Tausender von mehr oder weniger Gläubigen in einer großen Prozession an den Grenzen der Gemeinde entlang getragen worden war. Allerdings nur bis 1653, denn dann verbot Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen diese Riesenprozession und ordnete eine drastische Verkürzung auf einen Umgang um das Dorf an. So blieb es bis 1830. Dann wurde auch dieser Umgang durch Bischof Caspar Max verboten. Seit diesem Jahr stand die Figur ständig in der Nische. Aber ihre Verehrung endete nicht. Im Anschluss an die alte Prozession war schon im Mittelalter ein Jahrmarkt entstanden, aus dem sich die heutige Kirmes entwickelte, die immer noch am Sonntag nach dem Fest des heiligen Jakobus stattfindet, obwohl kaum ein Kirmesbesucher von dieser Tradition weiß. Die Pyramiden werden heute nicht mehr aufgestellt. Die Katharinenstatue selbst hat zwar die Jahrhunderte überstanden und steht auch heute noch in der Kirche, aber sie ist – wahrscheinlich mit dem Einbau des neugotischen Katharinenaltars um 1880 – stark verändert worden. Sie wurde gotisiert, das heißt, mit dem Schnitzmesser so bearbeitet, dass ihre barocken Formen sich in gotische verwandelten. Eine barbarische Methode, die aber damals nicht selten war. Es ist kaum anzunehmen, dass sie große Zustimmung in der Gemeinde gefunden hat. Der seit 1874 in Ascheberg tätige Lehrer Bernhard Buck schrieb 1890: „Das Bild der heiligen Katharina, das ein hehres Alter aufweiset, ist leider später in ganz anderer Weise umgearbeitet worden.“ Er war wahrscheinlich Zeuge dieses Vorgangs. Die Spuren der Bearbeitung sind noch zu erkennen, nicht auf den ersten Blick, aber beim genaueren Hinschauen. Besonders unter dem rechten Arm der Figur sind die Flickstellen sichtbar geblieben. Wozu diese Prozedur? Man weiß es nicht sicher. Vielleicht duldeten Pfarrer und Kirchenvorstand die alte Katharina nur unter der Bedingung neben dem neuen Katharinenaltar, dass sie ihm formal, das heißt im neugotischen Stil, angepasst würde. Ursprünglich war sie barock, denn sie ist wohl 1653 von Pfarrer Uhrwercker angeschafft worden, um der neuen Prozession auf ihrem neuen Weg auch eine neue Katharinenfigur mitzugeben. Die Ascheberger hingen auch um 1880 noch mit eigensinniger Liebe an ihr und trotzten allen Versuchen, sie durch eine größere und schönere zu ersetzen. So ist sie bis heute erhalten geblieben, und erst im 20. Jahrhundert haben sich das Interesse an ihr und das Wissen über sie verflüchtigt. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Dieningstrasse
|
Die Dieningstrasse beginnt, wo Bultenstraße und Appelhofstraße zusam-menstoßen, und endet am Plaß, das heißt, am südöstlichen Ende der Bultenstraße und am Anfang der Steinfurter Straße. Sie ist nach dem Hof des Schulzen Diening benannt, der etwa zwischen dem Rathaus, der Marien-apotheke und der Bäckerei Lüningmeyer lag. Er war dem Grafen von Galen hörig, wurde aber aus unbekannten Gründen im 19. Jahrhundert nicht abgelöst, sondern als Pachthof aus dem Dorf in die nahe Nordbauerschaft nach Vierhegen verlegt. Durch Einheirat erhielt er um 1900 den Namen Thyering. |
 |
|
Die Dieningstrasse war ursprünglich nur Dienings Hofweg, keine Dorfstraße und auch kein Durchfahrtsweg durchs Dorf. Zur Ortsmitte, also zur Kirche, fuhr man von Osten her über die Bultenstraße, die über den „Bulten“ oder „Bult“ verläuft. Das ist eine leichte Anhöhe, die westlich in den Kirchenbereich auf den Ascasberg übergeht und zwischen Kirche und Sandstraße endet. Dieser etwas höher gelegene Weg konnte relativ leicht trockengehalten werden, weil sein Oberflächenwasser nach beiden Seiten abfließen konnte. Er durchquerte eine Niederung, die auch heute noch teilweise erkennbar ist, an der Nordseite in Frenkings Weide, wo vor der Bebauung noch ein Rest des letzten Entwässerungsgrabens vorhanden war. An der südlichen Seite, also zur Dieningstrasse hin, ist die Senke heute kaum noch festzustellen. Alle Gärten und Grundstücke sind im Laufe der Zeit aufgefüllt worden. Wer aber vom Lebensmittelmarkt Frenster zur Apotheke geht, kann sehen, dass die Dieningstrasse ein wenig bergab führt, das heißt, eine Niederung durchquert, die vor Jahrhunderten zweifellos ausgeprägter war als heute. Zur Konermannstraße hin steigt sie dann wieder an, denn da beginnt der Ascasberg. Zweigt man von der Dieningstrasse die Gasse nach Süden zum Dieningholt ab, sieht man zwischen dem ehemaligen Haus von Dr. Hilgert und dem Haus Fallenberg einen kleinen Buckel. Hier verläuft eine kleine Anhöhe, die die Dieningsenke nach Süden abgrenzt. Das alles ist heute so minimal, dass es schwerfällt, diesen topographischen Befunden die Bedeutung beizumessen, die ihnen jahrhundertelang zugekommen ist. Zwischen Askasberg, Bultenstraße und dieser leichten südlichen Anhöhe im Dieningholt war eine Niederung, in der der Hof Schulze Diening lag. Er war zweifellos von einer Gräfte umgeben, die sowohl der Entwässerung als auch dem Schutz des Hofes diente. Beides war in dieser Lage gleich wichtig. Der Name „Diening“ ist eine Ableitung von einer Flurbezeichnung, die vermutlich „Dien“ oder „Den“ gelautet hat. Das mittelniederdeutsche „dene“ bedeutet „feuchte Senke“. Dieningstrasse und Bultenstraße zweigen an der gleichen Stelle von der Steinfurter Straße ab. Diese Stelle heißt von altersher „Plaß“, was meistens mit „der Platz“ übersetzt wird. Es gibt hier aber keinen Platz, der diesen Namen verdient hätte. Auch „Plaß“ ist ein altes Wasserwort und erinnert an eine Stelle zwischen dem östlichen Ende der Bultenstraße und dem angrenzenden Hoppenberg, die früher oft unter Wasser stand und an die sich alte Ascheberger noch erinnern. Sie muss in alten Zeiten so auffällig gewesen sein, dass der (vermutlich erste) Anwohner nach ihm benannt wurde: „Plässer = der am Plaß wohnende“ (Haus der Familie Weber). Auch heute noch sind diesem Bereich die kleinen Höhenunterschiede zu erkennen. Sie waren früher vor dem Ausbau der Straßen und dem Auffüllen der Hausgrundstücke etwas größer, betrugen aber auch damals kaum mehr als einen Meter, meistens weniger. Aber nur die relativen Höhenunterschiede sind entscheidend. Das sich stauende Wasser war auf Anhöhen wie in Senken ein großes Problem, das den Menschen das Wohnen und Arbeiten und den Verkehr schwer oder zuweilen sogar unmöglich machte. Kein Wunder, dass die ältesten Lokal- und Flurnamen Sumpfbezeichnungen waren, die aus der heutigen deutschen Sprache verschwunden sind. Auch der Name der Dieningstrasse gehört dazu. Anders als bei der Sandstraße und der Plaßstrasse ist „Straße“ hier nur eine amtliche Bezeichnung und kein eigenständiges Wasserwort im Sinne von Durchfluss oder Röhre. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Lambertusspiel
|
Das Lambertusbrauchtum in Ascheberg geht nicht auf den kirchlichen Lambertuskult zurück, denn es gibt unter den sogenannten Lambertusliedern keines, das die Verehrung des Heiligen zum Ausdruck bringt. Nirgends ist die Rede von seinen großen Taten oder persönlichen Tugenden. Anders als beim Martinsbrauchtum, bei dem die Legende von der Mantelteilung im Mittelpunkt steht, gibt es beim Lambertusbrauchtum kein vergleichbares Ereignis aus dem Leben des Heiligen. |
 |
|
Es ist vielmehr anzunehmen, dass der rund zwei Wochen später anstehende Michaelistag, ein Termin, der unter dem Kürzel „zu Michaeli“ in unzähligen, besonders arbeitsrechtlichen Regelungen eine große Rolle spielte, auf den Lambertustag „abgefärbt“ hat. Das heißt, dass man in den Kirchengemeinden mit Lambertuspatronat schon am Lambertustag das feierte, was eigentlich zu Michaeli fällig war: nämlich den Wechsel des Gesindes zu einem anderen Arbeitgeber, den Beginn der kürzeren Arbeitszeit, der ruhigeren Jahreszeit und der winterlichen Beleuchtung, die die sich immer mehr zurückziehende Sonne vertreten musste, was in alten Zeiten wohl auch mit magischen Vorstellungen verbunden war. Wer seine Arbeitsstelle verließ, um künftig anderswo zu arbeiten, nahm sich seinen bisherigen Arbeitgeber und seine „Berufskollegen“ vor und kritisierte ihre großen und kleinen Schwächen in spöttischen Liedern wie „Da schickt der Herr den Jockel aus“, „Dumme Liese, hole Wasser“ oder „O Buer, wat kost dien Hei?“. Alle wussten, was hier gemeint war, und hatten ihren Spaß daran. Dagegen zeigt das Lied „Guter Freund, ich frage dir . . .“ (in den ursprünglich plattdeutschen Texten gibt es keinen Unterschied zwischen „dir“ und „dich“, daher der Fehler), dass alle, besonders die Schulkinder, Bibel und Katechismus kennen und ohne langes Nachdenken die Zahl sechs den Weinkrügen zu Kana in Galiläa und die neun den neun Chören der Engel zuordnen können. Eltern, Lehrer und Pfarrer haben es sicher gern zur Kenntnis genommen. In der Ballade vom Edelmann und Schäfer geht es um adelige Gutsherren und ihre abhängigen Landleute, eine in naive Verse gekleidete Sozialkritik. Leider traf der Spott auch behinderte Menschen, die durch ihre Auffälligkeiten von der gesellschaftlichen Norm abwichen. Deshalb singt man das Lied vom hinkenden Mädchen Tria Humpelbein heute nicht mehr. Auch das Lied „Es waren mal drei Juden“ kann nicht mehr gesungen werden, obwohl es ursprünglich nicht antisemitisch gemeint war, sondern nur am Nimbus der biblischen Respektspersonen, der Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, kratzen wollte. Überall suchte und fand man menschliche Schwächen bei den im ernsten Alltag immer so untadeligen Vorgesetzten und Helden der Vergangenheit. Unsere heutigen Karikaturisten und Kabarettisten machen es ja ebenso. Psychologische Feinheiten waren nicht gefragt. Es ging nur um Schwarzweißbilder: faul und fleißig – klug und dumm – fromm und sündig – ehrlich und heuchlerisch. Die heute so bunten und freundlichen Laternen in den Händen der Kinder waren früher ausgehöhlte Kürbisse und Runkeln, aus denen das Licht durch Löcher in den Formen von Augen, Nasen und Mündern leuchtete. Gelangen den eifrigen Schnitzern lächelnde Gesichter, dann sah man gute Geister, sonst grinste aus mancher Laterne der Leibhaftige. Auch hier Hell und Dunkel, wie überall im Leben. Fragt man nach der Herkunft des Lambertusfestes, ist eine eindeutige Antwort nicht möglich. Vieles hat sich hier vermischt: ein bisschen Handwerker- und Bauernfest, ein bisschen Patronatsfest, ein bisschen Tanzfest und vielleicht auch ein bisschen altgermanisches Lichterfest. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Osterbauer-Schule wird 100 Jahre alt
|
Ein Ortsfremder wird größte Mühe haben, das Gebäude der ehemaligen einklassigen Volksschule in der Ascheberger Osterbauerschaft zu finden, selbst wenn er weiß, dass es unmittelbar an der Hauptstraße steht. Nachdem die Schule 1967 geschlossen worden war, verkaufte die Gemeinde das Haus. Der neue Besitzer nahm einige bauliche Veränderungen vor. Er verkleinerte die großen, für eine Schule typischen Fenster des Klassenraumes, ließ aber die breite, dreiteilige Tür an der Straßenseite, die ebenso typisch für eine Schule ist, bestehen, so dass der aufmerksame Sucher das Schulhaus an dieser Tür erkennen könnte. Es ist das westliche Nachbarhaus des "Gasthofs zur Mühle" an der B58. |
 |
|
Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit der Schließung der einklassigen Schulen in Nordrhein-Westfalen vergangen, und man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie Mädchen und Jungen aller Schuljahrgänge gemeinsam in einem Raum gleichzeitig von einem Lehrer unterrichtet werden konnten. Aber diese Schulen waren so sehr im Bewußtsein der Bevölkerung verankert, dass man noch 1960 in vielen Orten neue Gebäude für sie baute. Auch für die Osterbauerschule gab es Neubaupläne. Nicht nur als Idee, sondern 1963 ausführlich von den Architekten Kösters und Balke in Münster entworfen und gezeichnet. Vor genau 100 Jahren, am 01. März 1894, wurde die Schule eröffnet. Es ist anzunehmen, dass der Pfarrer das Haus eingesegnet und Bürgermeister oder Amtmann eine Ansprache gehalten und der neuen Schulgemeinde, den Kindern und dem Lehrer Glück und den Segen Gottes gewünscht haben. So ganz sicher ist das jedoch nicht, denn weder Pfarrer noch Gemeindeverwaltung wünschten diese Schule. Ja, sie hatten mit allen Mitteln gegen ihre Einrichtung gekämpft. Sie wollten nicht eine Bauerschaftsschule, sondern eine zusätzliche Klasse in der Dorfschule einrichten. "Es ist uns sehr viel daran gelegen, dass namentlich in jetziger Zeit, wo über die Verwilderung der Jugend so vielfache Klagen laut werden die Schule in der Nähe der Kirche und nicht neben einem Wirtshause steht." Auch die Windmühle gegenüber gefährde die Kinder durch ihren Betrieb. Im übrigen seien die langen Fußwege zur Dorfschule gesund, und die Kinder könnten dort auch mehr lernen. Aber die Königliche Regierung in Münster hatte dem Antrag des "Bollermann und Genossen" vom 31. Dezember 1888, in der Osterbauerschaft eine Schule zu bauen, am 12. März 1889 stattgegeben und alle Gegenargumente der Gemeinde abgelehnt. Sogar das letzte Eisen im Feuer der Gemeinde, nämlich die Anrufung des Petitionsausschusses des Preußischen Herrenhauses durch den Abgeordneten Pellengahr, war erkaltet. Im "VI. Verzeichnis der bei dem Hause der Abgeordneten eingegangenen Petitionen, 17 Legislaturperiode III. Session 1890/91" lautet die 50. Eingabe bei der Kommission für Unterricht: "Gemeindeverordnete und Schulvorstand zu Ascheberg (überreicht vom Abgeordneten Pellengahr) beschweren sich über die Anordnung einer Schulbehörde, in der Osterbauerschaft eine Schule zu errichten, statt den Beschluß der Gemeindevertretung, der Schule in Ascheberg eine Klasse zuzufügen, zu bestätigen. Aber auch da wollte die Kommission für das Unterrichtswesen der Gemeinde nicht beistehen. Nachdem Seine Exzellenz der Königliche Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, Dr. von Goßler, auf dem Dienstwege der Gemeinde Ascheberg mitgeteilt hatte, dass "ich.....die Gründung einer besonderen Schule in der Osterbauerschaft als notwendig ansehen muß", wurde die Schule gebaut. Das Grundstück kaufte man vom Landwirt Ahlmann, und das Gebäude errichtete im Jahre 1893 der Maurermeister Wilhelm Mangels, der aus dem Hause Mangels auf der Sandstraße stammte und sich bei Pelster-Lohoff (heute Goßheger) im Jackenort eingeheiratet hatte. Er starb noch während der Bauarbeiten, seine Witwe heiratete Heinrich Bergmann aus der Lütkebauerschaft (Bettmann/Rohlmann). Man baute ein Klassenzimmer mit einem kleinen Vorraum und daneben eine Dienstwohnung für den Lehrer. Dahinter setzte man ein Abortgebäude mit einer Waschküche und einen Stall für ein Schwein und eine Kuh, damit der Lehrer - wie das früher auf dem Land üblich war - etwas Landwirtschaft betreiben konnte. Dazu standen ihm drei Morgen Land zur Verfügung. Natürlich war auch ein großer Garten dabei. An der Westseite der Lehrerwohnung stand die Pumpe für den Lehrer und seine Familie, aber auch für den Schulbetrieb. Beheizt wurde der Klassenraum durch einen etwa zwei Meter hohen runden Eisenofen. |
|
Der erste "alleinstehende Lehrer" der Schule war August Eiling, geboren 1873 in Nordwalde. Er wurde Eiling-Buchtmann genannt, bis er im Mai 1903 seinen Namen gerichtlich in Eiling ändern ließ. 1899 heiratete er die Tochter Bernhardine des Bäckermeister Reher von der Sandstraße. Der junge Lehrer ging auch mit den Bauern aus der Osterbauerschaft auf die Jagd und saß mit ihnen abends im Gasthaus zur Mühle. Aus purem Jux versteckte er eines Tages das erlegte Wild in der Schule. Man kam ihm auf die Schliche und rächte sich, indem man ihm in der nächsten Nacht ein großes Schild mit der Aufschrift "Wild- und Geflügelhandlung August Buchtmann" über die Schultür hängte. 1906 verließ August Eiling die Osterbauerschaft und wurde Lehrer, später Rektor, in Bottrop. Dort starb er 1937. Er liegt auf dem Ascheberger Friedhof begraben. |
 |
|
Sein Nachfolger wurde Theodor Neukämper, geboren 1885 in Westenfeld bei Wattenscheid. Schon 1908 stellte die Regierung in Münster fest, dass die Osterbauerschule überfüllt sei. Sie war 1894 mit 70 Kindern eröffnet worden, aber in den Jahren bis 1908 war die Schülerzahl auf 87 angestiegen. Das sei zu viel, befand die Regierung, eine zweite Klasse müsse eingerichtet werden. Aber zunächst ließ der Landrat einige Kinder ins Dorf umschulen. 1909 bekam Davensberg eine zweite Klasse, aber die Osterbauerschule blieb einklassig. Von 1916 bis 1918 war Lehrer Neukämper Soldat. Die Lehrerin Maria Sicking und nach ihr der Lehrer Engelbert Stüve übernahmen die Vertretung. 110 Kinder hatte Lehrer Neukämper im Jahre 1918 zu unterrichten. Deshalb richtete man im Frühjahr 1919 eine zweite Klasse ein. Sie wurde in der ehemaligen Schneiderwerkstatt in dem Mühlengebäude der Gaststätte Fleckmann (Zur Mühle) eingerichtet. Elisabeth Theine aus Habighorst übernahm die Klasse, aber nur für zehn Monate. Dann kam Anna Kocks aus Ahaus für drei Monate, dann Mathilde Hundt aus Drolshagen. Sie blieb bis zum 30 April 1924, dann kündigte ihr die Regierung. Dieses Schicksal teilte sie mit vielen jungen Lehrerinnen und Lehrern, die fast alle in andere Berufe gingen. Am 01. Mai 1924 kam Anna Voshage aus Dortmund. Sie heiratete und schied aus dem Dienst aus. Die Lehrerin Johanna Lenfert aus Datteln blieb bis zum 01. April 1927. Dann wurde die zweite Klasse wieder aufgehoben und Fräulein Lenfert nach Nottuln versetzt. Die letzten zwei Jahre war das zweite Klassenzimmer nicht mehr in der ehemaligen Fleckmannschen Schreinerei, sondern in einem Zimmer des Gasthofes. Im Juni 1920 plante die Gemeinde, das Schulgebäude um einen Raum zu erweitern. Aber daraus wurde nichts. Nachdem Johanna Lenfert die Schule verlassen hatte, erteilte Regina Baake, Ascheberg, den textilen Handarbeitsunterricht für die Mädchen. Sie ging den Weg vom Dorf zur Osterbauer-Schule zu Fuß und bekam dafür im Jahr 20 Mark Wegegeld. Im Dezember 1918 überprüfte der Kreisarzt Medizinalrat Dr. Appelmann die Schulhygiene. Er empfahl, in den Abortanlagen den "Anstrich auf dem Pissoir zu erneuern, der zweckmäßig mit Teer vorgenommen wird". Diesen Rat befolgte die Gemeinde die nächsten 40 Jahre. Erst 1958 erhielt die Schule moderne Toiletten mit Fliesen an den Wänden. Lehrer Theodor Neukämper wurde zum 01. Mai 1932 an die Dorfschule versetzt. Sein Nachfolger war Josef Fladung, 1898 in Fulda geboren. 1932 wurde auch die zweite Klasse wieder eingerichtet, die die Hilfslehrerin Bernhardine Mennemann aus Ascheberg führte, aber nur bis zum 01. Oktober 1932, dann wurde sie "abgebaut", das heißt die Lehrerin, nicht die Klasse! Die wurde am 01. Mai 1933 von Theodor Heineke aus Hasede bei Hildesheim übernommen, der bis zum Frühjahr 1936 in der Osterbauer blieb. Dann ging er nach Bork. Hilfslehrer Friedrich Flöter aus Drensteinfurt wurde sein Nachfolger in der zweiten Klasse. In den Sommerferien 1936 erlitt Flöter einen Unfall. Ein Auto fuhr ihn an und verletzte ihn so, dass ihm das rechte Bein bis zur Mitte der Wade amputiert werden musste. Lehrer Fladung tauschte 1934 seine Stelle mit der des Lehrers Albert Müller in Marl. Müller stammte aus Schneidemühl, wo er 1889 geboren wurde. In Ascheberg gebärdete er sich, wenigstens in Worten, als strammer Nationalsozialist. Aber der NSDAP-Ortsgruppenleiter meinte, nur seine Sprache "triefe von Nationalsozialismus" für die Partei habe er nichts getan. Am 01. Oktober 1937 wurde er in den Ruhestand versetzt und zog nach Schneidemühl zurück. Als Friedrich Flöter wegen seiner schweren Verletzung den Dienst in der Osterbauerschaft aufgeben musste, schloß die Gemeinde die zweite Klasse, und Lehrer Müller unterrichtete 69 Kinder in einer Klasse. Lehrer Heinrich Ahle, 46 Jahre alt, übernahm am 01. Oktober 1937 die Schule. Er gehörte zu den ersten Männern, die 1939 in den Krieg ziehen mussten. Seine Vertretung übernahmen die Lehrer Rüter (Ascheberg), Poeplau (Drensteinfurt), Neukämper (Ascheberg), Bülte (Lüdinghausen und Schomberg (Ascheberg). Am 10. Januar 1942 konnte Heinrich Ahle wieder in die Osterbauer-Schule zurückkehren. Eine Verwundung in Rußland und eine Krankheit bewirkten seine Entlassung aus dem Kriegsdienst. Als in der Nazizeit der Religionsunterricht aus dem Stundenplan gestrichen wurde, gab es ihn am Nachmittag für alle Kinder, die freiwillig teilnehmen wollten, und zwar auf dem Hof Ahlmann, wo eine Stube dafür reserviert war. Pastor Fechtrup oder Kaplan Westmattelmann kamen dazu aus dem Dorf. Für den Sakramentenunterricht gingen die Kinder zum Pfarrhaus ins Dorf. Als nach dem Krieg die Schülerzahl wegen der Flüchtlings- und Vertriebenenkinder stark anstieg, wurde wieder eine zweite Klasse eingerichtet, die Maria Fietz aus Neustadt in Schlesien übernahm. Da aber kein zweiter Raum vorhanden war, musste nachmittags Unterricht erteilt werden. Zu Ostern 1954 sank die Schülerzahl auf 35, und die Schule war wieder einklassig. Maria Fietz wurde nach Vorhelm versetzt. Am 01. Dezember 1954 trat Lehrer Ahle in den Ruhestand. Sein Nachfolger war Wilhelm Pues, der am 01. April 1958 zuerst an die Sonderschule in Beckum und dann an die Schule in Drensteinfurt-Mersch versetzt wurde. Er war später Rektor der Drensteinfurter Grundschule und wohnte in der Wohnung der ehemaligen Schule in Mersch. Solange nur ein männlicher Lehrer in der Schule tätig war, musste der Unterricht in textiler Handarbeit für die Mädchen von einer entsprechend vorgebildeten Frau erteilt werden, auch wenn sie keine Lehrerin war. Viele Jahre kam Johanna Danne dazu aus dem Dorf in die Osterbauerschaft, bis ab 1963 Lehrerinnen dort tätig waren. Frau Danne war übrigens die erste weibliche Abgeordnete im Ascheberger Gemeinderat. Sie gab ihr Mandat 1965 auf, als sie nach Köln zog. Der letzte "Alleinstehende Lehrer" in der Schule Osterbauerschaft war Reinhard Schütte von 1958 bis Ostern 1963. Dann wurde er an die St.-Michael-Schule im Dorf versetzt. Dabei nahm er die Klassen fünf bis acht aus der Osterbauerschaft mit. Die restlichen Klassen eins bis vier wurden von Elisabeth Westhues-Schäper und ab 01. Oktober 1966 von Elisabeth Roters unterrichtet. Mit Beginn der Sommerferien 1967 wurde die Schule in der Osterbauerschaft geschlossen, und alle Kinder fahren seitdem mit dem Bus in die Dorfschule. Die Neubaupläne blieben in der Schublade und wanderten schließlich ins Gemeindearchiv, wo sie heute noch sind. Sie sahen eine eingeschossige Schule mit zwei Klassenzimmern und den damals erforderlichen Nebenräumen vor. Eine Wohnung für den Lehrer war unter dem gleichen Dach mit angebaut. Die neue Schule lag südlich der alten und damit in größerem Abstand von der B 58, die zu der Zeit als Autobahnzubringer ausgebaut wurde. Die Schule in der Osterbauerschaft ist 73 Jahre alt geworden. In all den Jahren waren sich die Eltern dort weitgehend einig: Die Gemeinde mag unsere Schule nicht und mochte sie vom ersten Tag an nicht. Wenn mal etwas repariert wurde, dann so, wie es einmal ein Gemeindearbeiter, wenn auch Augenzwinkern, ausdrückte: "För ne Burschopsschool is dat gued genog". Das heißt: Es darf nicht viel kosten. Erst gegen Ende der 50ger Jahre begriff man im Ascheberger Rathaus, dass eine Schule in so schlechtem Zustand wie die in der Osterbauerschaft nicht nur die Schulkinder dort erheblich benachteiligte, sondern auch ein Schandfleck für die Gemeinde war. In den Jahren 1958/59 erhielt das Gebäude ein neues Dach, der Klassenraum Fenstervorhänge, eine Gasheizung, einen neuen Anstrich (dreifarbig wie in der Dorfschule) und nach mehr als 30 Jahren endlich zwei weitere Lampen, denn die vorhandenen zwei hatten noch nie ausgereicht. Auch der kleine Vorraum mit der Garderobe bekam eine Lampe. Die Gasheizung verlängerte man sogar bis in die Lehrerwohnung, und bis Ende 1965 wurden dort zwei Zimmer und der Küchenherd mit Gas beheizt. Inzwischen ist das alles fast vergessen. Manches ist heute kaum noch zu begreifen. Aber alles ist ein Stück der Ascheberger Schulgeschichte, und deshalb soll zum 100. Geburtstag der Osterbauer-Schule daran erinnert werden. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Der Katharinen-Stift
|
Seit Pfarrer Wennemar Uhrwerker nach dem Dreißigjährigen Krieg in Ascheberg ein geordnetes Schulwesen einführte, ist das Interesse an einer soliden Grundbildung in dieser kleinen Landgemeinde nicht erloschen. Pfarrer Degener ist noch zur Kinderzeit unserer Eltern Ortsschulinspektor und durch dieses Amt eng mit allen Fragen der schulischen Bildungsarbeit verbunden. Als die Technisierung gegen Ende des vorigen Jahrhunderts allmählich auch die ländlichen Haushalte ergreift und die Nähmaschine das Spinnrad an Bedeutung übertrifft, zeigt sich die Notwendigkeit einer gründlichen Schulung der Mädchen und Frauen in allen Bereichen der textilen Arbeit. |
 |
|
Der preußische Kultusminister hatte die wöchentlichen Handarbeitsstunden für die Mädchen in den Volksschulen von 4 auf 2 beschränkt, und der Pfarrer Degener findet, das sei nicht genug. Er lobt in einem Schreiben an das Generalvikariat in Münster den Eifer der Ascheberger Lehrerinnen in dieser Sache, bittet aber um die Genehmigung zur Eröffnung einer Handarbeits- und Haushaltsschule, die er gern den Schwestern von der Göttlichen Vorsehung in Münster, Friedrichsburg, übertragen möchte. Gleichzeitig könnten die Schwestern und die jungen Mädchen eine Kinderbewahrschule betreiben und jene Kinder versorgen, die wegen Überlastung ihrer Mütter mit Arbeit daheim nicht ausreichend gepflegt werden können. Es gab auch damals Mütter, die arbeiten gehen müssen, um die Existenz ihrer Familien zu sichern. Pfarrer Degener berichtet von Ascheberger Mädchen, die morgens zu Fuß zur Nähschule nach Herbern oder Nordkirchen gehen und abends wieder heimkehren, was ja nicht ohne Gefahr sei. Das Interesse der Eltern an dieser Mädchenbildung sei so groß, dass viele ihre Töchter für ein halbes oder ein ganzes Jahr in anderen Orten unterbrächten, um ihnen die Vorteile einer Näh- und Haushaltsschule zu vermitteln. Gegen Weihnachten 1901 trägt Pfarrer Degener seinen Plan der bischöflichen Behörde vor. Im Januar 1902 kommt die Zustimmung, auch die Königliche Regierung in Münster erhebt keine Bedenken, die Vorsehungsschwestern sind bereit und schließlich wünscht das Generalvikariat noch "fröhliches Gedeihen". Wo soll die Schule eingerichtet werden? Der Freiherr von Fürstenberg in Herdingen bei Neheim-Hüsten ist damals Besitzer des Armenhauses an der Sandstraße. Dieses sog. Ichterloher Armenhaus war bis ins 18. Jahrhundert hinein Eigentum der Herren von Ascheberg auf Ichterloh gewesen, von deren Erben später verkauft worden und schließlich mit dem gesamten Ichterloher Besitz an den Freiherrn von Fürstenberg gelangt. Der Herr von Fürstenberg ist bereit, der Pfarrgemeinde Ascheberg das Armenhaus zu schenken. Pfarrer Degener hält es allerdings für seine Pläne nicht geeignet. Man nimmt es aber an und veräußert es wieder an die Familie Franz Hegemann. Die neue Handarbeits- und Haushaltsschule, die den Namen Katharinenstift erhält, wird an der Nordkirchener Straße gebaut. Die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung studieren die Baupläne des Baumeisters Gottfried Merten und ihr gesunder Sinn für die Realitäten des Lebens konfrontiert sie sogleich mit dem Idealismus des Ascheberger Pfarrers. Im Auftrage ihrer Mutter Oberin weist Schwester Ansgaria sehr höflich darauf hin, dass das Haus unterkellert werden müsse. Wo soll man denn Kohlen, Kartoffeln, Wasch- und Bügelräume unterbringen? Der Pastor antwortet, gestützt auf ein Sachverständigengutachten, dass wegen des hohen Grundwasserstandes keine Keller gebaut werden könnten. So ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Der Schenkungsvertrag zwischen dem Herrn von Fürstenberg und der Pfarrgemeinde sieht vor, dass die Pfarrgemeinde vier armen Frauen, die eigentlich ein Anrecht auf einen Armenplatz hätten, eine geeignete Unterkunft zu gewähren hätte. Man beschließt, die Armenpflege den Schwestern im Stift zu übertragen, wo sich die armen Frauen noch durchaus nützlich machen könnten. Der Grundstein wird gelegt am Tage Dominica in albis, dem Weißen Sonntag 1903. Die Urkunde für den Grundstein ist in lateinischer Sprache abgefaßt und wird an der südöstlichen Ecke eingemauert. Auf einem Zettel, der sich im Pfarrarchiv befindet, hat Pfarrer Degener den Text notiert: Ad maiorem Sanctissimae Trinitatus gloriam - In honorem Stae. Catharinae V.M. - Aschebergensium magnae Patronae coelestis - Ad salutem totius Sti. Lamberti parochiae - Incolae Aschebergenses hanc domum exstruxere. Ad recipiendas feminas egentes - Ad conservandos instituendosque infantes - Ad instruendas artibus domesticis virtutibusque christianis puellas et virgines - Eique praefecerunt Sorores a Divina Providentia nuncupatas. (Zur größeren Ehre der Allerheiligen Dreifaltigkeit, zu Ehren der heiligen Jungfrau und Blutzeugin Katharina, der großen himmlischen Patronin der Ascheberger, zum Heil dieser ganzen Lambertuspfarrei haben die Ascheberger dieses Haus erbaut, um arme Frauen zu pflegen, Kinder zu behüten und zu belehren und die jungen Mädchen zu unterweisen in der Kunst des Haushaltens und in den christlichen Tugenden, und sie haben die Leitung den Schwestern vom Orden der Göttlichen Vorsehung übertragen.) Dann folgt die Aufzählung aller regierenden und leitenden Persönlichkeiten, die man in Gründungsurkunden üblicherweise nennt: Leo XIII., ein Greis von dreiundneunzig Jahren, war damals Papst. Wilhelm II. war Deutscher Kaiser, Hermann Dingelstad Bischof von Münster, Josef Degener Pfarrer von Ascheberg. Wilhelm Schulte und Ferdinand Waßen waren Kapläne in Ascheberg und Bernhard Viehoff in Davensberg, das damals noch nicht selbständig war. Mitglieder des Kirchenvorstandes waren Wilhelm Heiling, Bernhard Neuhaus, Franz Wentrup, Friedrich Westhof, Wilhelm Bose, Hugo Hobbeling, Franz Pellengahr und Hubert Geismann. Gemeindevorsteher waren Friedrich Press und Wilhelm Greive. Kaum sind dem neuen Katharinenstift seine ersten pädagogischen Gehversuche geglückt, da hat der unermüdliche Pastor Degener mit seinem Kirchenvorstand schon neue Pläne. Der Landkreis Lüdinghausen will eine landwirtschaftliche Schule für die jungen Bauern einrichten, eine Winterschule. Die Stadt Lüdinghausen bewirbt sich als Kreisstadt verständlicherweise sofort darum, Standort dieser Schule zu werden. Amtmann Press und Pfarrer Degener sind jedoch der Meinung, eine solche Schule gehöre nicht in die Stadt, sondern aufs Land, zwischen Äcker und Weiden. Wegen seiner günstigen Lage im nordöstlichen Kreisgebiet sei Ascheberg der beste Schulort. Außerdem könnten auch die Schüler aus Orten außerhalb des Kreises Lüdinghausen, etwa aus Amelsbüren, Hiltrup und Rinkerode leicht nach Ascheberg kommen. Die Eingaben des Pfarrers Degener und des Amtmanns Press an den Kreisausschuss und die Königliche Regierung in Münster sind psychologisch geschickt formulierte Plädoyers für Ascheberg. Der Aufenthalt in der Stadt Lüdinghausen bringe doch für die sehr jungen Bauernsöhne einige Gefahren mit sich. Die Schüler höherer Schulen könnten die 14- bis 20jährigen Jungen vom Land verachten oder sonst ungünstig beeinflussen. Eine Landwirtschaftsschule benötige Versuchsäcker, die eine Stadt wohl kaum zur Verfügung stellen könne, wohl aber Ascheberg. Die politische Gemeinde unterstützte den Pfarrer, der zusammen mit dem Amtmann Press ein Internat für die Winterschüler im Stift anbietet. Im März 1907 entscheidet der Landeshauptmann in Münster, dass Ascheberg der Sitz der neuen Landwirtschaftlichen Winterschule wird. Auch der Generalvikar gibt seine Genehmigung, bittet aber, die Haushaltsschülerinnen ein wenig von den jungen Herren im Internat zu trennen. Pfarrer Degener teilt mit, die Schwestern im Stift würden schon das Notwendige veranlassen. Für die Wintermonate würde der Handarbeitsunterricht der Mädchen nicht im Stift, sondern in einem anderen geeigneten Lokal im Dorf gehalten. Trägerin der Schule ist die Gemeinde Ascheberg. Sie ist bereit, wie Amtmann Press an die Landwirtschaftskammer schreibt, "Opfer für dieselbe zu bringen und die Schule auf den Gemeindeetat zu übernehmen, falls ihr von Seiten der Landwirtschaftskammer und des Kreistages Zuschüsse in angemessener Höhe zugesichert werden." Für die Überlassung der Schul- und Internatsräume im Stift zahlt die politische Gemeinde an die Kirchengemeinde eine Miete. Die Winterschule wird am 5. November 1907 mit 39 Schülern eröffnet. Der Pensionspreis für das Internat beträgt etwa 200 Mark für das Winterhalbjahr vom 1.11. bis zum 1.4., das Schulgeld 30 Mark. Im Winter 1907/08 wohnen 15 Schüler im Internat, 21 im Elternhaus und 3 Auswärtige Schüler in Ascheberger Privathäusern. Der Direktor der Winterschule, Landwirtschaftslehrer Wilhelm Tillmann und Pfarrer Degener leiten die Schule gemeinsam. Das Internat wird geleitet von dem geistlichen Rektor Kaplan August Konermann, der auch an der Rektoratschule unterrichtet. Kreistierarzt Tillmann aus Lüdinghausen erteilt den Unterricht im Fach Tierheilkunde und im Jahre 1908 tritt Pfarrer Wigger aus Capelle dem Kollegium als Zoologielehrer bei. Die Schülerzahl, besonders die der Internatsschüler steigt, das Stift wird zu klein. Im Jahre 1911 beschließt das Schulkuratorium einen Neubau der Winterschule, die inzwischen in die Trägerschaft des Kreises Lüdinghausen übergegangen ist. Die Kirchengemeinde stellt das Grundstück nördlich des Katharinenstiftes zur Verfügung, und die Bauunternehmer Kalthoff und Klaverkamp aus Ascheberg errichten im Sommer 1911 nach den Plänen des Kreisbaumeisters Wethmar aus Lüdinghausen das neue Gebäude. Im Gegensatz zum Katharinenstift wird dieses Gebäude aber unterkellert. Die Keller liegen fast zur ebenen Erde. Das sei in Ascheberg nahezu überall so, hatte Pfarrer Degener schon 1902 den Vorsehungsschwestern mitgeteilt. Die Schulräume liegen im Erdgeschoss. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafräume des Internats und die Wohnung des Rektors. Im November 1911 beginnt der Schulbetrieb im neuen Haus. Schul- und Internatsleben sind streng geregelt. Alljährlich findet im März die große Abschlussprüfung statt, die öffentlich ist, und an der auch immer 50-60 Gäste teilnehmen. Es sind meistens die Eltern der Schüler, die ihre Jungen anschließend mit nach Hause nehmen. Nach dem ersten Semester werden die Eltern dringend gebeten, ihre Söhne auch zum 2. Semester im folgenden Herbst zur Winterschule anzumelden, da erst danach das Studium voll abgeschlossen werde. "Auf Wunsch werden braven strebsamen und zuverlässigen Schülern Volontär- bzw. Verwalterstellen besorgt." Im Jahre 1912 läßt sich der Bischof von Münster, Felix von Hartmann, der spätere Kardinal und Erzbischof von Köln, über den Stand der Schule berichten und spricht der Schulleitung sein hohes Lob aus. Besonders freut sich der Bischof darüber, dass das Stift auch für Exerzitien zur Verfügung gestellt wird. Solche geistlichen Übungen und Einkehrtage werden im Stift noch viele Jahre hindurch abgehalten und geben den Nationalsozialisten später Anlass zu mißtrauischen Beobachtungen, wie uns Pfarrer Jodokus Fechtrup überliefert hat. Im Jahre 1921 geht die Landwirtschaftsschule Ascheberg in die Trägerschaft der Landwirtschaftskammer in Münster über. Das Internat bleibt in der bisherigen Weise bestehen. Im Jahre 1959 wird die Landwirtschaftsschule nach Lüdinghausen verlegt. Das St. Katharinenstift wurde im Jahre 1970 vom Sozialwerk St. Georg gekauft. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Plettenberg’sche Wappen in der St. Lambertus Kirche
|
Hoch über dem Mittelgang der Pfarrkirche St. Lambertus befindet sich oberhalb des Chorbogens ein Relief aus Sandstein mit der Abbildung von zwei adeligen Wappen. Wegen des trüben Lichtes und der großen Entfernung sind Einzelheiten nur schwer zu erkennen. Unter einer fünfblättrigen Krone stehen zwei ovale Schilde mit den Wappen der Eheleute Ferdinand von Plettenberg und Bernhardine Felizitas von Westerholt zu Lembeck. Sie waren Besitzer und Bauherren des Schlosses in Nordkirchen und ließen in den Jahren 1737 bis 1740 das Chor der Ascheberger Kirche erbauen. Deshalb sind ihre Wappen da oben angebracht. |
 |
|
Das Plettenberger Wappen (links) ist gespalten in eine goldene und eine blaue Hälfte. Da der Sandstein nicht farbig gefaßt ist, sind die fehlenden Farben durch Schraffuren ersetzt, das Gold durch Punkte, das Blau durch waagerechte Linien. Das Westerholt-Lembecksche Wappen der Ehefrau ist geviertelt. Die Flächen oben links und unten rechts sind in silberne und schwarze Felder aufgeteilt, die silbernen sind unschraffiert, die Schwarzen kariert. Die anderen Flächen zeigen auf rotem Grund (senkrecht gestreift) je ein silbernes Nesselblatt mit drei blauen Nägeln, die aber wegen ihrer geringen Größe nicht schraffiert sind. Die zwei Schilde sind umrahmt von der Ordenskette des Goldenen Vlieses, die aus stilisierten Flammen und Feuerställen (Feuer- oder Schürfeisen?) zusammengesetzt ist. Darunter hängt, etwas dunkler gefärbt, das Goldene Vlies. Die beiden Wappenschilde sind nach barocker Art von Schmuckgebilden umgeben. Der Orden vom Goldenen Vlies wurde 1430 von Philipp dem Guten, Herzog von Burgund, anläßlich seiner Vermählung mit Isabella von Portugal in der flandrischen Stadt Brügge gestiftet. Als Maria von Burgund 1482 den Kaiser Maximilian I. heiratete, kam Burgund und mit ihm der Orden vom Goldenen Vlies an das Haus Habsburg. Seit 1714 gilt diese Auszeichnung als die höchste der österreichischen und auch der spanischen Habsburger, und sie steht auf einer Stufe mit dem Hosenbandorden in England und dem Elefantenorden in Dänemark, den vornehmsten Auszeichnungen der Welt. Das Goldene Vlies ist ein goldenes Schafsfell (Widderfell), das an einem breiten Ordensband so aufgehängt ist, dass Kopf und Vorderbeine des Schafes links und die Hinterbeine rechts von der Aufhängung zu sehen sind. Herkunft und Bedeutung dieser Auszeichnung sind nicht restlos geklärt, denn das Goldene Vlies stammt aus der griechischen Sage von den Argonauten, einer Gruppe von seefahrenden Helden, die über das Schwarze Meer segelten, um das entführte Fell eines goldenen Widders zurückzuerobern. Das gelang ihnen auch, und das Goldene Vlies besitzt seitdem den Charakter einer Kostbarkeit, eines Symbols für den Stein der Weisen, für die geheime Wahrheit hinter den Dingen und nicht zuletzt für die Sehnsucht nach Größe und Herrlichkeit, weshalb es auch machtpolitischem Streben dienen musste. Was den Herzog Philipp von Burgund 1430 bewog, dieses eigentümliche Zeichen zu einer besonderen Auszeichnung zu machen, ist nicht bekannt. Es müssen sehr subjektive Vorstellungen von den Argonauten der griechischen Sage gewesen sein. Vielleicht hielt er sich für die ersten Ritter des Abendlandes. 1714 ließen die Habsburger den Orden vom Goldenen Vlies in Österreich wieder aufleben, und 1724 ernannte Kaiser Karl VI. den Freiherrn Ferdinand von Plettenberg, der Minister des münsterschen Fürstbischofs Klemens August von Bayern war, zum Reichsgrafen und verlieh ihm den Orden vom Goldenen Vlies. Graf Plettenberg regierte damals für seinen Landesherrn dessen fünf geistliche Fürstentümer Münster, Paderborn, Osnabrück, Köln und Hildesheim. Er war also ein mächtiger Mann und hoffte sogar, am Kaiserhof zu Wien in allerhöchste Staatsämter zu gelangen. Die Eheleute von Plettenberg-Westerholt beabsichtigten, an der Ascheberger Kirche, deren Patronatsherren sie als Rechtsnachfolger der Familie Morrien waren, einen Chorraum anzubauen und in ihm ihre Grablege einzurichten. Bevor es aber dazu kam, starb Graf Ferdinand am 18. März 1737 in Wien und wurde dort in der Minoritenkirche beigesetzt. Daraufhin verzichtete seine Witwe auf das Erbbegräbnis in Ascheberg. Sie ließ aber trotzdem das Chor von Johann Conrad Schlaun anbauen, der seit 1725 die Leitung der Schloßbaustelle in Nordkirchen innehatte. Er plante für die Ascheberger Kirche nichts nur den Chorraum, sondern darüber hinaus einen Turm mit einer geschweiften Haube als Ersatz für den allgemein als nicht schön empfundenen alten romanischen Wehrturm. Schlauns Kirchturm wurde nicht gebaut, wohl aber der Choranbau. In seinen Plan für das Chor zeichnete er das Plettenberg-Westerholtsche Wappen im Gewölbebogen mit ein. Er entwarf außerdem einen barocken Hochaltar, von dem aber außer dem Bild Gottvaters mit den Engelköpfen, das sich auch auf dem heutigen Hochaltar befindet, und einer Katharinenstatue im Pfarrhaus, nichts mehr erhalten ist, denn 1885 wurde er durch einen neugotischen Altar ersetzt. Es wurde damals alles radikal gotisiert. Das Plettenbergsche Wappen verbannte man in die Sakristei, wo es gelegentlich das Interesse der Meßdiener hervorrief. Den Platz über dem Chorbogen ließ die Kirchengemeinde damals mit einem Gemälde ausfüllen, an das sich die Elteren noch gut erinnern: Christus mit Maria, Johannes dem Täufer und zwei Engeln. Jesus trug eine fünfblättrige Krone und Johannes ein Spruchband mit den Worten: Ecce Agnus Dei! (Seht das Lamm Gottes.) Diese Darstellung ist keineswegs selten, aber als Ersatz für das Plettenbergsche Wappen an diesem Ort doch bemerkenswert, denn es zeigen sich hier Parallelen, die kein Zufall sind. Die Krone des Patronatsherrn wird ersetzt durch die Krone Christi, des Hausherrn dieser Kirche, der statt schwer deutbarer Wappenbilder die Buchstaben A und O, bekannte Symbole der Ewigkeit, in seiner linken Hand hält. Auch das Glaubenszeugnis des Johannes "Seht das Lamm Gottes" ist hier als eine Anspielung auf das Schafsfell des Goldenen Vlieses zu verstehen, denn die Kirche mißbilligte immer ein wenig das "heidnische" Widderfell dieser von den katholischen Habsburgern verliehenen Auszeichnung und hätte es lieber als das biblische Schafsfell des Gideon (Buch der Richter 6,36-40) gedeutet, das Gott mit himmlischem Tau tränkte. Deshalb wurde in Ascheberg der Hinweis auf das Gotteslamm aus dem Mund des Täufers Johannes gewählt und damit zu verstehen gegeben, dass in dieser Kirche an kein anderes Lamm zu denken ist. Man kann in dem Gemälde verschlüsselt die Ablehnung adliger Ansprüche an diesem Gotteshaus und nicht minder eine Absage an den Geist des 18. Jahrhunderts erkennen, der ein Adelswappen dort zuließ, wo nur das Bild Christi angemessen war. 1959 holte man das Plettenberg-Westerholt-Wappen wieder aus der Sakristei und gab ihm seinen alten Platz über dem Chorbogen zurück, nachdem das Gemälde mit einer Deckfarbe übermalt worden war. Einen barocken Hochaltar mit Kommunionbank und Chromstühlen erwarb man in Holland, so dass im Winter 1959/60 der Zustand von 1740 einigermaßen wieder hergestellt war. Das war auch wohl die Absicht der damals Verantwortlichen, wenn auch keineswegs der Wunsch aller Katholiken in Ascheberg, von denen nicht wenige die bunte Kirche ihrer Kindheit sehr vermißten. Aber auch mancher, der der Neugotik nicht nachtrauert, hätte das Gemälde über dem Chorbogen gern beibehalten trotz der etwas schwachen Mariendarstellung. Für das Plettenberg-Wappen hätte sich wohl ein anderer geeigneter Platz gefunden. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Das Vereinshaus
|
Das große, weiß-schwarze Fachwerkhaus am südlichen Kirchplatz hieß früher "Vereinshaus", denn es sollte den Veranstaltungen der kirchlichen Vereine dienen. Pünktlich zum Goldenen Priester- und Silbernen Ortsjubiläum des Pfarrers Josef Degener, den der Papst zum Prälaten ernannt hatte, wurde es im Jahre 1924 fertig. Seit dem großen Brand am östlichen Kirchplatz im Jahre 1903 dachte die Pfarrgemeinde daran, nicht nur die Kirche östlich zu erweitern, sondern auch ein Vereinshaus auf den Grundstücken der abgebrannten Häuser zu errichten. |
 |
|
Sie erwarb die Grundstücke, und die Eigentümer erhielten Bauplätze an der Dieningstrasse, wo Graf Galen Land zur Verfügung stellte. Nachdem die zwei vom Brand verschonten Häuser direkt neben dem Pfarrhaus auch abgebrochen werden konnten, entstand hier das neue Vereinshaus, das - wie könnte es anders sein - sofort allgemein mit Kritik bedacht wurde: Schwarz- weißes Fachwerk gehört ins Sauerland, aber nicht nach Ascheberg, das Bauholz ist nicht abgelagert und noch so grün, dass es vermutlich weiter wächst, der Pastor bricht alles übers Knie - kurz: Das kann ja nichts werden. Kaum einer beachtete, dass die Gestaltung das alte Kirchplatzensemble respektierte, denn der Neubau ahmte äußerlich die Formen der vier abgebrochenen Häuser nach, was auch heute noch gut zu erkennen ist. Ursprünglich waren alle Ascheberger Fachwerkhäuser mit grauem Lehmverputz und, so gut es ging, mit weißem Kalkanstrich versehen. So unmöglich war die Gestaltung gar nicht, sie entsprach durchaus der heimattümelnden Tendenz jener Zeit. Aber was die Kritiker sonst noch gegen die hastige Bauerei vorzubringen hatten, war nicht ganz von der Hand zu weisen, denn schon 1981/82 musste das ziemlich marode Haus völlig neu gebaut werden. Zur Einweihung am 29. Dezember 1924, die gleichzeitig mit den Jubiläen des Prälaten stattfand, hatte Schulrektor Anton Otte ein Preisgedicht mit 19 Strophen erstellt, das mit viel Juchheidi-Juchheida gesungen wurde. In den folgenden 58 Jahren war im Vereinshaus "immer was los". Der Saal diente vielen Veranstaltungen, Einquartierungen von Soldaten und SS- Einheiten im Krieg, einigen Familien als Notwohnung während der Beschlagnahme durch die Amerikaner, nach 1946 auch eine Zeit lang der evangelischen Kirchengemeinde für den Gottesdienst. Der Kindergarten, die Pfarrbücherei und die Rektoratsschule, waren darin für einige Zeit untergebracht. Es gab auch ein kleines Einzelhandelsgeschäft und im Obergeschoß drei Mietwohnungen. Im großen Saal ermöglichte eine eingebaute Bühne die Aufführung von Theaterstücken durch Laienspielscharen. Ebenso fanden darin Konzerte, Chorgesang, Vorträge und Schulentlassungsfeiern statt .Durch zwei Kohleöfen wurde der Saal beheizt, ein dritter stand im so genannten "kleinen Saal', der durch große Türen vom Hauptsaal abgetrennt werden konnte. Daneben war ein kleinerer Raum für viele Zwecke, und natürlich gab es auch ordentliche Toiletten. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Am Karfreitag 1945 wurde Ascheberg besetzt
Dr. E. Pistorius, Aachen
|
Ascheberg. Mitte März 1945 mehrten sich die Anzeichen dafür, dass die Front im Westen ins Wanken geriet. Trecks mit zahllosen Fremdarbeitern zogen, von Männern des hiesigen Volkssturmes geleitet, durch Ascheberg. Sie wurden hier verpflegt; ihre materielle Not wurde durch Spenden mitleidiger Menschen nach Kräften gemildert. Immer näher kam die Front. Die Verantwortlichen des Dritten Reiches hatten das Ausmaß unserer Niederlage noch nicht erkannt. Sie glaubten, mit dem Aufgebot des Volkssturmes, lauter ältere oder militäruntaugliche Leute, die große Wende herbeiführen zu können. Am 28. März erhielt Hugo Merten in seiner Eigenschaft als Volkssturmführer vom Kreisleiter in Lüdinghausen ein Schreiben folgenden Inhalts: „Ich ernenne Sie hiermit zum örtlichen Widerstandskommissar. Jedes feige und ehrlose Verhalten ist durch sofortiges Erschießen zu ahnden.“ Hugo Merten war sich über die Tragweite dieses Schreibens keinen Augenblick im Zweifel: Lehnte er ab, konnte es ihn den Kopf kosten. Er musste annehmen, bestand doch die Gefahr, dass sonst ein unbelehrbarer Fanatiker mit allen Vollmachten ausgerüstet worden wäre. Die Bürger Aschebergs hatten zu Hugo Merten volles Vertrauen. Sofort nach Empfang des Schreibens berief er seine bewährten Mitarbeiter zu sich in die Bultenstrasse und beriet die Lage. Alle Anwesenden, die Volkssturmführer Josef Wintrup, Lehrer Ahle aus der Osterbauerschaft, auch der Ortsgruppenleiter, die Polizeiwachtmeister Ott und Berlage und der Verfasser dieses Artikels, widersetzten sich einer Verteidigung des Ortes mit den unzulänglichen Waffen. |
 |
|
Am Karfreitagmorgen mussten Volkssturmleute noch Fremdarbeiter auf Befehl des Kreisleiters nach Sendenhorst bringen, und gegen Mittag erhielt Wintrup den Befehl zum Einsatz seiner Volkssturm-Kompanie nach Lüdinghausen, was er aber mit allerhand Ausflüchten zu verhindern wusste. Gegen Nachmittag fand in der Bultenstrasse im Hause Merten die denkwürdige Sitzung mit dem aus Lüdinghausen gekommenen Kreisleiter statt. Ich selbst war bei dieser Sitzung nicht anwesend, weil ich auf Befehl der Kreisleitung in der Sandstraße in der Nähe von Schulze Frenking eine Panzersperre auszubauen hatte. Die 5 Pflastersteine, die ich mit Hilfe von 6 Männern des Volkssturmes ausgehoben hatte, wurden auf die Nachricht von der Abfahrt des Kreisleiters wieder sorgfältig eingefügt. Er verlangte in der oben erwähnten Sitzung den sofortigen Einsatz des Volkssturmes. Wir hatten nur 5 Gewehre und einige hundert Patronen. Bei den Panzerfäusten fehlten die Sprengkapseln. Niemand wusste, wo sie geblieben waren. Hugo Merten machte den Kreisleiter auf das Unsinnige seiner Forderung aufmerksam, indem er erklärte, dass dieses Verlangen organisierter Selbstmord sei. Angesichts dieses energischen Widerstandes wurde der Kreisleiter weich und gab den Befehl, die Waffen an die letzten durchziehenden deutschen Truppen abzugeben. Noch bei der Abfahrt, im Wagen stehend, rief er aus: „Und dennoch bis zum Siege!“ Nun begann Hugo Merten zu handeln. Der Hitlerjugend wurde befohlen, in Ascheberg zu bleiben. Vielen Eltern fiel ein Stein vom Herzen. Der Volkssturm trat nicht in Aktion. Der Vorschlag, weiße Fahnen zu hissen, wurde einmütig abgelehnt, solange noch deutsche Truppen vor uns kämpften. Nun setzten sich Merten und Wintrup auf Motorräder und fuhren gegen Westen, bis sie auf die Vorhuten der Amerikaner und damit auch auf unsere letzten Verteidigungstruppen trafen. Dies war die Kampfgruppe Major Gärtner, bestehend aus 3 Offizieren und 70 Mann, die nur wenige moderne Waffen hatten. Die Amerikaner stießen nur sehr zögernd nach. Merten und Wintrup fuhren auf Nebenwegen nach Ascheberg zurück und trafen die oben erwähnten deutschen Truppen am Bahndamm an der Straße Lüdinghausen - Ascheberg wieder. Merten veranlasste die Truppen, ins Dorf zu marschieren, wo die Offiziere bei Merten, die Mannschaften von den Einwohnern gastlich aufgenommen wurden. In einer „Generalstabsbesprechung“ wurde die Lage erörtert, wobei gerade durch den Rundfunk die Nachricht kam, dass das Ruhrgebiet von Süden her umgangen würde. Die Offiziere beschlossen nun, sich nach Osten abzusetzen. Auf Lastwagen der Wehrmacht fuhr die letzte deutsche Einheit nach Drensteinfurt, und Frau Merten hat mit dem PKW noch 3 Verspätete der Kampfgruppe Gärtner nachgefahren. Über das weitere Vordringen der Amerikaner war Merten durch engen Kontakt mit der Wirtin Ermke bestens unterrichtet. Merkwürdigerweise funktionierte das Telefon noch. Hierdurch erfuhren wir, dass ein Teil der Panzerspähwagen auf Ascheberg, ein anderer nach Ottmarsbocholt im Anmarsch sei. Unterdessen saßen Wintrup und ich bei Merten und warteten der Dinge, die da kommen sollten. Wir wunderten uns und konnten gar nicht verstehen, dass die amerikanischen Vorhuten gegen Abend noch nicht das Dorf erreicht hatten. Die Spannung stieg ständig. In dieser Situation erklärte sich Wintrup bereit, die Lage zu sondieren und stellte die ersten Amerikaner am Ortsausgang nach Lüdinghausen fest. Die Verhandlungen führten in Ermangelung der notwendigen Sprachkenntnisse zu keinem Ziel, worauf ich mich nach Rückkunft von Wintrup bereiterklärte, mit ihm zu den Vorhuten der Amerikaner zu gehen. In dieser Zeit wurde der Elektriker Grundkötter von einem übereifrigen Amerikaner erschossen. Am Dorfausgang trafen wir keinen Amerikaner mehr an. Die Straße war menschenleer. Eine weiße Schürze zwischen uns schwenkend, gingen wir bei Platvoet vorbei und sahen im hellen Vollmondlicht an der Abzweigung nach Lüdinghausen die ersten Amis, die abgesessen neben ihren Panzerspähwagen standen. Wir machten uns von weitem bemerkbar, um nicht das Schicksal Grundkötters zu teilen. Ich begrüßte die Soldaten in meinem besten Schul-Englisch, wurde aber von den übermütigen Siegern nicht ganz ernst genommen. „Wie weit ist es bis Berlin?“ fragte einer, der es besonders eilig zu haben schien. „300 Meilen“, antwortete ich, stolz darauf, dass ich die Kilometerzahl so fix umgerechnet hatte. „Kann ich mit Dr. Goebbels telefonieren?“ fragte mich ein anderer Witzbold. Darauf wusste ich keine Antwort. Ich bat, einen Offizier kommen zu lassen, um die Übergabe des Ortes anzubieten. Als dieser nach kurzer Zeit erschien, beteuerten Wintrup und ich, dass keine deutschen Truppen im Ort Ascheberg seien. Diese Behauptung war nicht ganz ungefährlich; denn es hätten ja mittlerweile noch versprengte Einheiten aus Richtung Nordkirchen eintreffen können. Fast zur selben Zeit begann ein lebhaftes Schießen zwischen Bahndamm und den amerikanischen Vorhuten. Am späten Nachmittag war auch noch der Hof von Beutelmann in der Hegemerbauerschaft von SS-Truppen in Brand geschossen worden. Nach unserer Fühlungnahme mit den Amerikanern traten wir erleichtert den Heimweg an. Die Amerikaner schossen uns noch einige Salven nach, die aber absichtlich hoch über unsere Köpfe gingen. Vielleicht wollte man nur etwa im Dorf vorhandene deutsche Truppen warnen. Im „Hauptquartier“ bei Merten hatte man schon das Schlimmste für Wintrup und mich befürchtet. Die amerikanischen Panzerspitzen setzten sich nun in Marsch; die ganze Nacht rollten über die Biete und die Steinfurter Straße Panzer, Jeeps und Lastwagen gegen Osten. Die unmittelbare Gefahr, in das Kampfgeschehen einbezogen zu werden, war vorbei; die Heimat war vor unsinniger Zerstörung bewahrt. Am nächsten Morgen nahmen Merten und ich Fühlung mit dem amerikanischen Ortskommandanten, einem Oberleutnant der Nachrichtentruppe, auf. Er hatte seine Dienststelle im Amtshaus eingerichtet und zeigte sich als ein vernünftiger Mann. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass eine Reihe der besten Häuser für die Truppen beschlagnahmt wurden. Es war eben Krieg. Auf die Auswahl der zu räumenden Häuser hatten die deutschen Stellen keinen Einfluss; immerhin gelang es mir als Dolmetscher, die größten Härten abzubiegen. Die Bevölkerung schickte sich in das Unabwendbare. Zuerst durfte niemand vor 12 Uhr die Straße betreten. Vielen unserer Mitbürger wird es gewiss noch in Erinnerung sein, dass sie am Ostersonntag - manche zu ersten Mal in ihrem Leben - nicht dem Gottesdienst beiwohnen konnten. Später wurden Passierscheine ausgegeben. Der mit Spannung geladene Karfreitag und die nachfolgende Schreckenszeit werden in Ascheberg unvergessen bleiben. (siehe auch unter Geschichte Teil 4) (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Antoniusfigur an der Sandstraße
|
Im Vorgarten des ehemaligen Hauses Claes (heute Baron von Twickel) steht eine steinerne Figur des hl. Antonius von Padua mit dem Jesuskind auf dem Arm. Kaum ein Ascheberger weiß etwas von der Geschichte dieser Figur, die in der Folge eines Unglücksfalles entstanden ist. Der gegenüber liegende Bauernhof war im 19. Jh. im Besitz der Familie Heuckmann, im Jahre 1827 der Eheleute Jodokus Heinrich Heuckmann und Anna Schulze Frenking. Ihre zwei kleinen Jungen, der dreijährige Bernhard Antonius, und sein etwas älterer Bruder Franz Heinrich spielten auf dem Hofgelände, auf dem es damals noch eine Gräfte gab. Der kleine kam dem Wasser zu nahe, rutschte hinein und ertrank vor den Augen des größeren Bruders, der ihn aber nicht mehr retten konnte. Vielleicht war er aber auch selbst noch zu klein, um irgendeine Hilfe leisten zu können. Das Unglück ereignete sich am 6. August 1827. Diese traurige Begebenheit ist nirgends dokumentiert, sondern nur durch mündliche Überlieferung bekannt. Es wird erzählt, der ältere sei auf dem Hof herangewachsen, habe die damals übliche landwirtschaftliche Ausbildung erhalten und als künftiger Erbe auch auf dem Hof der Eltern geheiratet. Das erste Kind aus dieser Ehe sei 1853 ein Junge gewesen, der den jungen Vater sehr an den ertrunkenen kleinen Bruder erinnert habe. Deshalb hätten er und seine Frau beschlossen, aus Dankbarkeit für die glückliche Geburt ihres Sohnes und gleichzeitig zum Gedenken an das vor vielen Jahren verunglückte Kind Heinrich Antonius eine Statue des hl. Antonius von Padua aufzustellen. Wahrscheinlich waren das Jesuskind auf dem Arm des Heiligen und der Name des verunglückten Kindes, der Grund für diese Wahl. Die Heuckmanns hätten einen Holzschnitzer aus der Verwandtschaft der Bäckerei Hülsmann auf der Dorfheide damit beauftragt. Dieser schuf eine Holzstatue, die auf dem Hof Heuckmann aufgestellt wurde, ob im Haus oder auf dem Hofgelände oder an der Sandstrasse, ist nicht bekannt. Die Figur kam später – wann, ist ebenfalls nicht bekannt – in das Haus der Bäckerei Hülsmann auf der Dorfheide und befindet sich dort noch heute. |
 |
|
Warum das geschah, ist nicht überliefert. Es fällt dem Betrachter allerdings auf, dass der Bildhauer dem Heiligen sehr individuelle Gesichtszüge gegeben hat, was in so einem Fall nicht üblich war. Man kann vermuten, dass hier ein Porträt geschaffen wurde, vielleicht das des Vaters oder Großvaters des kleinen Jungen. Das ist wohl anfangs begrüßt oder wenigstens akzeptiert worden, könnte aber nach längerer Zeit vielleicht doch als zwar gut gemeint, aber etwas „übertrieben fromm“ gestört haben. Außerdem war eine Holzfigur in einem Bildstock oder unter einem nicht wettersicheren Dach nicht genügend geschützt, so dass man sie durch die heutige Steinfigur ersetzte. Trotzdem hätte die Holzfigur im Haus der Stifter bleiben können. Vielleicht hat die damalige Familie Hülsmann aber ein besonderes Interesse an der Figur gezeigt und sie erworben oder geschenkt bekommen. Der Hof Heuckmann und mit ihm die Antoniusfigur sind später durch Verkauf in den Besitz der Familie Schlingermann gekommen. Da eine Schlingermann-Tochter den Direktor der Landwirtschaftsschule, Josef Claes, heiratete und auf dem geerbten Grundstück das heutige Haus von Twickel erbauen ließ, ist vielleicht erst in diesem Zusammenhang die steinerne Antoniusfigur geschaffen und im Vorgarten aufgestellt worden. Das müsste um 1920 gewesen sein. Das Haus wurde von dem Drensteinfurter Architekten Bernhard Kruse entworfen, der eine Reihe von Villen in neubarocken Formen baute. Warum trägt Antonius von Padua das Jesuskind auf dem Arm? Die Heiligenlegenden geben keine eindeutige Antwort. Ein besonderes Ereignis scheint dieser Darstellung, die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts üblich wurde, nicht zugrunde zu liegen. Das Jesuskind soll wohl auf die besondere demütige Liebe des Antonius zu Jesus hinweisen. Er war ein Spanier, lebte in Italien, besonders in Padua, wo sich sein Grab befindet. Er starb am 13. Juni 1231, nur 36 Jahre alt. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Himmelstraße
 |
|
Warum heißt eine Dorfstraße „Himmelstraße“? Sie hat doch nichts zu tun mit der blauen Luft und den weißen Wolken über uns, auch nichts mit dem unseren Vorstellungen entzogenen „Ort Gottes“, den alle frommen Christen sich als ihren Ort für die Ewigkeit erhoffen! Julius Schwieters, der Historiker des alten Kreises Lüdinghausen, hat vor mehr als einhundert Jahren eine Erklärung abgegeben, die auch heute noch in Ascheberg zu hören ist. Der „Himmel“ sei eine frühere germanische Opferstätte, die nach der Christianisierung demonstrativ einen den neuen Glauben betonenden und bekennenden Namen erhalten habe. Das sei ein kluger Zug der Missionierungsstrategie gewesen und habe zur Festigung der christlichen Lehre bei unseren Vorfahren gedient Wer in Nord- oder Süddeutschland auf „Himmelsorte“ trifft, wird auch dort Erklärungen hören können, die den religiösen Bezug in ähnlicher Weise hervorheben. Es gibt auch Varianten, die „Himmel“ in einem übertragenen Sinn deuten! So z. B. in Kirchzarten bei Freiburg, wo das “Himmelreich” in der hier beginnenden Rheinebene den mittelalterlichen Jakobspilgern auf der Wanderung nach Santiago de Compostella in Spanien als eine Erlösung, als ein Geschenk des Himmels, erschien, nachdem sie soeben das unwegsame „Höllental“ verlassen hatten. Seitdem die moderne Ortsnamen- und Flurnamenforschung, von der Schwieters nichts wissen konnte, weiß, dass viele alte Namen durch volkstümliche Umdeutung auch in ihrem Lautstand verändert wurden, sucht sie nach dem ursprünglichen Grundwort, das zumindest in Resten in dem zu deutenden Namen verborgen ist. Beim „Himmel“ ist es die Silbe „him“, die als Urbaustein zurückbleibt. Dazu gibt es die Ableitungen „ham – hem – hom – hum“, denn Vokale spielen eine untergeordnete Rolle. Hamm, Hemmer, Homburg, Humbrink gehören dazu, und alle bedeuten im Grunde das gleiche: wasserreiches Gelände. Das Hamfeld in Drensteinfurt war immer „ein ganz nasses Loch“, wie ein Anwohner sagte. Die Hemisburg in Albersloh liegt an der Werse, die wie alle Flüsse im Tiefland zu Überschwemmungen und Sumpfbildung neigte. Ähnlich ist es bei dem Ascheberger Hambrock, ein hierzulande typisches Urwort für ein einst nasses Bruchgelände. Die Orts- und Flurnamenforschung konnte nur durch internationalen Vergleich zu sachgerechten Deutungen kommen, die nicht von der Mythologie, sondern von der Topographie ausgehen. Für den nördlichen Teil der heutigen Himmelstraße ist ein besonderer Wasserreichtum belegt durch Aussagen von Augenzeugen. Als in den dreißiger Jahren die Bäckerei Reher neu erbaut wurde, gab es sehr große Probleme bei der Abdichtung der Kellerräume, weil der Grundwasserdruck hier ungewöhnlich stark war. Die alten Leute sahen damals ihre Erfahrung bestätigt, dass der „Himmel“ – wie man früher kurz sagte – ein sehr tief gelegenes, nasses Land gewesen war. Mündlich ist überliefert, dass bis etwa 1820 dort ein kurzer Graben das Quellwasser in den damals noch offenen Bach in der Sandstraße leitete. Der Gasthof Reher sei deshalb scherzhaft „Überwasser“ genannt worden, weil er nur über eine Brücke erreichbar war. Die „Himmelstraße“ ist also für die Namenforschung ein verhältnismäßig günstiger Ort, denn die einst namengebenden Wasserverhältnisse sind uns heute nicht fremd, wenn auch die moderne Kanalisation und die Auffüllung der Böden vieles verändert haben. Zugegeben – die romantischmythologische Deutung, die uns Julius Schwieters vor einhundert Jahren hinterlassen hat, ist nicht ohne Reiz, aber sie lässt völlig außer acht, dass „Wald und Sumpf einst als souveräne Herrscher regierten und die Vorstellungswelt der Namenschöpfer beherrschten“, wie der Namenforscher Edward Schröder sagt. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Figur des Heiligen Lambertus
|
Kein Namenstag, nicht einmal der der Heiligen Maria findet in Ascheberg soviel Beachtung wie der des Kirchenpatrones St. Lambertus, obwohl kaum ein Ascheberger Mann so heißt. Das liegt an den Lambertusspielen, die hier schon seit alten Zeiten üblich sind. Diese sind aber inhaltlich nicht auf einen Lambertuskult ausgerichtet, sondern auf die früher im September (Michaelistag) stattfindende Wende im ländlichen Arbeitsjahr mit dem Gesindewechsel und dem Beginn der winterlichen Beleuchtung. Deshalb singt man Spottlieder auf die menschlichen Schwächen der Mägde, Knechte und Bauern und trägt dabei bunte Laternen. Ursprünglich sind die Teilnehmer und Darsteller dieser Spiele hauptsächlich Erwachsene gewesen, wie heute noch beim Spiel „0 Buer, wat kost din Hei“? Die bunten Laternen tragen jedoch nur noch kleine Kinder. Alle Legenden und Berichte über das Leben des Heiligen Lambertus dokumentieren seine moralische und kirchenpolitische Größe. Darum zeigt das neue Ascheberger Lambertusbild, das 1989 von dem Kölner Künstler Theo Heiermann geschaffen wurde, eine Seite der Persönlichkeit des Heiligen, die zweifellos auch wirksam gewesen sein muss: die liebevolle Zuwendung zu den Schwachen und Kleinen. |
 |
|
In der Regel wird Lambertus als Bischof dargestellt, meistens mit den Waffen (Schwert, Lanze, Pfeil), die ihn töteten, in der Hand. In einem Einzelfall, nämlich auf einem Altarflügel, den der Kölner Maler Bartholomäus Bruyn der Altere (1493 - 1555) malte, trägt er auch eine kleine Kirche, vermutlich weil er bei der Missionierung in Toxandrien (Brabant) Kirchen gründete. Das Altarbild hängt in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München. Aber auch da gibt es Unklarheiten, denn der Maler wollte ursprünglich dem Heiligen ein Buch in die Hand geben. Während der Arbeit änderte er sein Konzept und malte das Kirchenmodell. Über seine Gründe ist nichts bekannt. Allerdings gibt es schon seit 1900 unter den Fachleuten Zweifel, ob der Heilige auf dem Bild tatsächlich Lambertus von Maastricht ist. Als der münstersche, aber aus Ascheberg stammende Bildhauer Anton Rüller 1910 die Lambertusfigur über dem Turmportal in Ascheberg schuf (und sogar stiftete), gab er dem Heiligen ein Kirchenmodell in die Hand. Vielleicht hat er das Münchner Bild gesehen und dieses Attribut seiner Einmaligkeit wegen für seine Heimatgemeinde Ascheberg wiederholt. Übrigens ist so eine Lösung bei ihm kein Einzelfall: Dem Evangelisten Lukas am Turmportal der münsterschen Lambertikirche gab er den Kopf Goethes. Die älteste erhaltene Lambertusdarstellung befindet sich im Siegel des Bischofs von Lüttich, Rudolf von Zähringen, der 1190 starb. Zu den Jüngsten - falls sie nicht die Jüngste überhaupt ist -zählt die Figur des Heiligen mit dem lampiontragenden Mädchen in Ascheberg. Theo Heiermann war 1988 von der Pfarrgemeinde beauftragt worden, ein Kind mit einem Lampion neben den Heiligen zu stellen. Bei dieser Entscheidung spielte die traditionelle Ikonographie keine Rolle; man wünschte sich einen Bezug zu den Lambertusspielen. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Die Ascheberger "Bauernkrippe"
| Wie alle Krippen ist auch die Ascheberger eine Deutung des Evangeliumstextes nach Lukas 2,1 -20. und Matthäus 2,1 -12. Sie ist allerdings kein Gemälde aus einem Guss, sondern im Laufe von annähernd 100 Jahren nach den Vorstellungen verschiedener Künstler und Auftraggeber entstanden. Anton Rüller, der in Ascheberg gebürtige und in Münster zu hohem Ansehen gelangte Bildhauer, schuf um 1900 die Heilige Familie, die Hauptgruppe jeder Krippe, die Hirten und die Heiligen Drei Könige. Es sind zwar keine schriftlichen Unterlagen bekannt, die das belegen, aber früher erwähnten die alten Leute das häufig mit einem Anflug von Stolz, dass ein Junge aus ihrer Gemeinde so eine Kunst hervorgebracht hatte. Auch Julia Merten, die vor vielen Jahren im hohen Alter verstorbene in Ascheberg geborene Lehrerin, die Anton Rüller gekannt hat, betonte es immer mit Nachdruck. |  |
|
Das Kamel stammt aber aus einer anderen Werkstatt. Der Bildhauer Herbert Vogeley im Heilbad Heiligenstadt hat es 1991 durch Vermittlung der Familie Hembrock geschaffen, allerdings nur als Rohling, das heißt ohne farbliche Fassung. Bemalt wurde es von dem Malermeister Albert Mangels. Auch die anderen Tiere, also Ochs, Esel und Schafe, sind noch nicht alt. Sie sind Arbeiten der Bildhauerin Gertrud Büscher-Eilert aus in Horstmar aus dem Jahre 1986 und wurden von einer privaten Gruppe in Ascheberg gestiftet. Die älteren Schafe, deren Bildner nicht bekannt ist, wurden damals ausgeschieden, weil sie als nicht zu den alten Figuren passend empfunden wurden. Den großen Krippenstall hat Helmut Walzel im Jahre 1968 gebaut. Er wählte ein schwarzweißes Fachwerkgebäude mit Brettergiebel und Strohdach und passte den Stall damit der uralten Bauweise der ländlichen Häuser in unserer Heimat an. Bevor das Ausmauern des Fachwerkes mit Ziegeln im Münsterland auch bei den Häusern der kleinen Leute üblich wurde, gab es nur das Lehmflechtwerk, das grauweiß verputzt wurde und nur anfangs so schön weiß erstrahlte wie das Krippenhaus. Dass heutige Krippengestalter die Geburt des Jesuskindes in die heimische Landschaft verlegen, auch in eine Großstadtstraße oder vor die Kulisse eines Hochofens, wird auch von etwas konservativen Christen im allgemeinen akzeptiert. Das war aber früher keineswegs so, wie das Beispiel der Kirchengemeinde St. Clemens in Telgte, der Stadt des Krippenmuseums, zeigt. Als 1935 eine münsterländische Bauernkrippe angeschafft wurde, gab es zornige Proteste von engagierten Katholiken, die hier den Einfluss des Blut-und- Boden-Kultes der Nazis wirksam werden sahen. Für die Darstellung der Geburt Christi galten damals die mittelalterlichen Altarbilder als vorbildlich. Die kleine Hirtenfamilie die im Jahre 1994 neu zur Krippe gekommen ist, wurde von dem Hobby-Bildschnitzer Hans Hettenberger aus Bottrop geschaffen. Sie ist die jüngste Gruppe der Krippe, während die Heiligen Drei Könige zu den ältesten Figuren gehören. Früher war es üblich, die Könige mit ihrem Kamel und dem Kamelführer erst am Epiphaniefest (6.Januar) aufzustellen. Jetzt werden sie schon am 2. Weihnachtstag aufgebaut, allerdings nicht vor der Heiligen Familie, sondern zunächst noch im Hintergrund. Unter ihnen erregte der schwarzhäutige König immer das besondere Interesse der Kinder, denn Menschen mit schwarzer Hautfarbe waren früher so gut wie nie auf unseren Straßen zu sehen. Das Gleiche gilt auch für das ewig dankbar kopfnickende Negerkind, dem die Kinder gern einen Groschen in seine Gelddose warfen und das an keiner Krippe fehlte. Heute wird es als rassendiskriminierend empfunden und nicht mehr aufgestellt. Aber ein kleiner Opferstock ist immer in der Nähe. Ochs und Esel sorgten zwar für eine gewisse Stallatmosphäre, werden aber im Weihnachtsevangelium nicht erwähnt. Sie entstammen der energischen Mahnung des Propheten Jesaja (1,3): "Der Ochs kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht.“ Deshalb zeigen auch manche Kirchenkrippen nur die Köpfe dieser Tiere, so früher in Rinkerode und heute noch in Drensteinfurt. Sie gehören nicht zur Szenerie, sondern mahnen den christlichen Glauben an, auch wenn fromme Großmütter den Kindern gern erzählen, sie hätten mit ihrem warmen Atem das Jesuskind vor der Kälte im Stall zu Bethlehem bewahrt. Wer nach Symbolen und Zeichen sucht, findet sie in der Krippendarstellung reichlich: die immergrünen Pflanzen Tanne und Moos, die Schafe, die Hirten, den Stall auch die idyllischen Zutaten wie Hirtenfeuer, Brücken und sorgfältig angelegte Wege. Eine Krippe ist keine weihnachtliche Kirchendekoration, sondern eine Dokumentation des christlichen Glaubens. Deshalb wird auch das große Kreuz an der östlichen Wand nicht durch Pflanzen oder einen Vorhang verdeckt - es ist Bestandteil der Krippe. |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Bultenstraße
| Wer sich mit Hochmooren auskennt, kennt auch den Bult-Schlenken-Komplex, d.h. die Wasserflächen mit den bewachsenen kleinen Hügeln darin. Mit Bult bezeichnet man auch in der "normalen" Landschaft einen Hügel in einem Naßgebiet, und eine Schlenke - das Wort ist auch umgangssprachlich bekannt - ist eine Wasserfläche, kein Teich und keine Kuhle, sondern ein seichtes Gewässer. Deshalb werden gelegentlich auch große Pfützen so bezeichnet. Ein Bult wurde, wenn er sich in die Länge zog, als Weg benutzt, denn hier konnte das Regenwasser leichter abfließen und eine einigermaßen passable Trasse garantieren, die man schließlich zu einer befestigten Straße ausbauen konnte. Der erste Ansiedler auf einem Bult wurde manchmal auch nach diesem benannt und bekam dann den Namen Bultmann oder Bültmann, Bülthues, Bültering, Bulthoff und vielleicht auch Bolte. Außer der bekannten Bultenstraße im Dorf gab es auch in der Ascheberger Osterbauerschaft einen Bulten, der heute nicht mehr unter diesem Namen bekannt ist, aber dem aufmerksamen Wanderer, besonders dem Radwanderer wegen der spürbaren Steigungen, nicht verborgen bleibt. Wer vom Daverthauptweg zum Heubrok fährt, bemerkt zwischen den Häusern Greive und Rottmann einen leichten Anstieg, der sich an Rottmanns Hofkreuz verstärkt und an Haverkamp, Bultmann und Schilling vorbei sich fortsetzt bis zum Haus Koch-Westerholt. |
 |
|
An den kleinen Rastplatz des ACA bei Wobbe erreicht der Buckel mit 66.7 m seinen höchsten Punkt. Zum Emmerbach hin sinkt das Gelände etwas ab. Die 65-m-Höhenlinie, die die Anhöhe begrenzt, kreuzt an der Wegegabelung bei Schulte den Heubrokweg, verläuft nördlich von Beckmann parallel zum Emmerbach in Richtung Davensberg, umrundet Schulze Pellengahrs Kotten und den Dicken Buschk und kehrt in einem großen Bogen zu Rottmann zurück. Die Häuser Schulte und Kleykamp im Süden und Mersmann, Steinhorst und Schulze Pellengahr im Norden liegen deutlich niedriger. Diese Anhöhe muss ursprünglich Bult oder Bulten genannt worden sein, denn an ihrem westlichen Ende lag vor der Emmerbachsenke der 1865 nach einem Brand untergegangene Hof Bultmann, der zweifellos nach seiner Lage auf diesem schmalen knapp 600 Meter breiten und etwa 2 km langen Hügel benannt worden ist. Keiner der innerhalb der 65-m-Höhenlinie gelegenen Höfe ist älter als Bultmann. Alle Nachbarhöfe entstanden im 19. Jahrhundert, als ein großer Hof dort Land verkaufte und damit Gelegenheit zur Ansiedlung bot. Schwieters erwähnt um 1880 den Hof Bultmann nicht mehr, nach Dr. Helmut Müller wurde er schon 1498 registriert. Hundert Jahre später, 1590, gab es einen Hermann thor Bult im Dorf, der seinen Namen aber wahrscheinlich dem Bult am Askasberg, der heutigen Bultenstraße, verdankte.
Ein weiterer Hof in der Osterbauerschaft könnte seinen Namen einem Bult verdanken: Bollermann, der nach Müller 1419 to Baldermennynk hieß. Die Lage dieses Hofes und das d in dem damaligen Namen können ein Hinweis darauf sein, dass auch hier ein Bult namengebend war. Auch der Hof Bollermann liegt am nördlichen Rande eines 63 bis 65 Meter hohen Buckels, der sich nach Süden bis in den Hagen hinein erstreckt. Nach Norden schließt sich zur Rinkeroder Grenze hin ein deutlich niedrigeres Gebiet an. Dass die Anhöhe Bulten genannt wurde, ist nicht erwiesen, aber nicht auszuschließen, denn auch hier fließt ein Bach, der heute sehr begradigte Holthoffbach. Für unsere Theorie wäre es bequemer, wenn der Hof Bollermann Boltermann oder Bultermann hieße, aber auch in Baldermannynk kann durchaus ein " Bult" verborgen sein. (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Düstere Kammer
| Zwischen den Häusern Wismann und der Gaststätte Geismann zweigt eine schmale Gasse mit dem einprägsamen Namen „Düstere Kammer“ von der Bultenstraße zur Biete ab. Im Jahre 1993 wurden die alten Wirtschaftsgebäude an der Westseite und die etwa zwei Meter hohe Mauer abgebrochen, die bis dahin tatsächlich die Gasse etwas verdunkelt hatten, so dass mindestens das Adjektiv „düster“ durchaus plausibel erschien. Aber auch die Bezeichnung „Kammer“ für die überschaubare kurze Gasse galt allgemein als ohne weiteres verständlich. Als der Gemeinderat vor Jahren über Straßenlaternen zu entscheiden hatte, sprach man sich für eine sparsame Beleuchtung der Gasse aus, um ihrem Namen gerecht zu werden. |
 |
|
Nun gibt es auch in Nordkirchen eine Straße mit dem Namen „Düsterkammer“. Auf einem Lageplan des Nordkirchener Schlosses aus seiner Bauzeit Anfang des 18.Jahrhunderts ist die Flur „Düsterkammer“ zwischen dem Schloss und dem Ortskern eingezeichnet. Eine besondere Düsternis ist aber an dieser Stelle nicht erkennbar, jedenfalls heute nicht mehr, und sie könnte um 1700 höchstens durch ungewöhnlich dunklen Bewuchs bewirkt worden sein, der aber nicht namengebend gewesen sein kann, denn Bäume wachsen und vergehen wieder. Nach ihnen benannte man keine Flur. Man muss also nach einer anderen Erklärung suchen. Vielleicht entwickelte sich „düster“ aus einem längst vergessenen und einem anderen Bedeutungsfeld zugehörenden, aber ähnlich lautenden Wort. In der Tat findet sich im Wörterbuch von Wilhelm und Jakob Grimm eine Vokabel, die heute keiner mehr kennt: „Dust“. Sie bedeutet nur Negatives und wurde in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen benutzt. Dust konnte Schmutz und Staub, Wertloses und Unbrauchbares, schlechtes Holz, Spreu und sogar Regen bedeuten. Ein Stück Land, das wegen ungewöhnlicher Nässe oder Trockenheit für den Menschen weitgehend wertlos war, könnte durchaus als „dustig“ oder „duster“ bezeichnet worden sein. Ob das nun für die „Düster(en) Kammern“ in Nordkirchen und Ascheberg zutrifft, ist heute nicht mehr zu überprüfen. Da aber in Ascheberg die Biete und die benachbarten Fluren Unland, Humbrink, Aaland und Dorfheide ursprünglich landwirtschaftlich wenig ergiebig, teilweise auch ziemlich nass waren, kann auch die „Düstere Kammer“ nur eine ähnlich unfruchtbare Ecke gewesen sein. Es lag natürlich nahe, das niederdeutsche Wort „Dust“ oder – als Adjektiv verwendet – „duster“ mit „düster“ ins Hochdeutsche zu übersetzen. Der Delmenhorster Stadtteil „Düsternort“ verdankt seinen Namen einer ehemaligen seenreichen Heidelandschaft, in der sich viele wasserreiche unreife Moore befanden. Solche grünen Moore nannte man „Dust“. Der Kiliansbach südlich von Cappenberg hieß ursprünglich „Düsterbach“. In Herbern-Nordick und in Wessel gibt es die „Düsterbecke“ und den „Düsberg“. Beide enthalten „Dust“. Aber auch die Bedeutung von „Kammer“ ist nicht leicht zu finden. Die Gasse könnte schon in alter Zeit mit Steinen befestigt gewesen sein, und deshalb, vielleicht sogar etwas ironisch, als Camminus bezeichnet worden sein, was eigentlich „steinerne Römerstraße“ bedeutet. Ein mittelalterlicher Pfarrer oder studierter Standesherr könnte hier seine Lateinkenntnisse vorgeführt haben, und nach und nach wurde aus dem „dusten Kamminus“ eine „düstere Kammer“. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Wort „Kamm“ mit angeklungen ist, denn nach dem Grimmschen Wörterbuch kann es auch „aufgeworfener Erdwall“ bedeuten. Vielleicht musste man die Gasse immer wieder mit Sand, Erde und Steinen ausbessern, so dass im Laufe der Zeit ein Damm entstand. Vielleicht! (siehe auch unter Straßen) |
 Seitenanfang Seitenanfang |
Sandstraße
|
Die Sandstraße in Ascheberg verbindet die Nordkirchener Straße mit der Biete und teilte früher das Dorf in Zwei Hälften. Das ist wegen der großen neuen Wohngebiete heute nicht mehr der Fall. Früher standen an ihrem nördlichen Ende das St.-Lambertus-Hospital und am westlichen Ende das St.-Katharinen-Stift. Ziemlich genau in der Mitte, auf dem schon im Werdener Urbar um 890 als Ascasberg bezeichneten Hügel steht die Pfarrkirche St. Lambertus. Nicht nur die Sandstraße verband früher die genannten Endpunkte, sondern auch ein Bach, der vom Katharinen-Stift aus quer über das Gelände des heutigen Friedhofs und durch Rohlmanns Weide zur Lüdinghauser Straße floss, dieser bis zur Sandstraße folgte und weiter - hier aber verrohrt - den Melkpatt begleitete und dann wieder offen in den Emmerbach mündete. Vor einigen Jahren war von ihm zwischen der Adamsgasse und der Lüdinghauser Strasse noch ein offenes Stück zu sehen, das aber inzwischen auch verrohrt ist. Eine kleine Holzbrücke, die heute funktionslos ist, erinnert noch an ihn. Als in den 1960er Jahren der Friedhof seine heutige Größe erhielt, bekam auch der Bach ein weiteres Bett. An der Eschenbachstrasse entlang verlief er breit ausgebaggert nach Norden zum Vennkamp und in einem großen Bogen ebenfalls zum Emmerbach. Es gibt also zurzeit zwei Dorfbäche, die beide nur wenig „zu tun haben“, denn die immer weiter ausgedehnte Kanalisation nimmt ihnen viel Wasser weg. |
 Um 1900 Um 1900 |
|
Aber beide Bachläufe entsprechen nicht dem ursprünglichen Bach, der von der Nordkirchener Strasse aus geradeaus durch die Sandstrasse floss, von Seitenwegen begleitet und an vielen Stellen überbrückt war. Wo heute das Florian-Pumpentürmchen steht, berührte er die Gräfte des Kirchenbezirks und etwas weiter die des Hofes Schulze Frenking. Dann floss er geradeaus weiter zum Emmerbach. Der Name des Baches ist nicht bekannt, auch seine Quelle nicht. Sie müsste nach dem Urmesstischblatt von 1841 in der Nähe des Hofes Greive in der Hegemerbauerschaft gelegen haben. Aber das ist nicht mehr festzustellen. Jedenfalls aber nahm er eine Reihe kleinerer Zuflüsse auf und drängte sein Wasser in die Sandstraße. Der heimatkundlich sehr interessierte Pfarrer Jodokus Fechtrup, von 1933 bis 1954 in Ascheberg tätig, wusste, dass der Bach im Dorf manchmal „recht ungemütlich“ werden konnte, wenn er über seine Ufer trat. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass eine tagebuchartige Notiz des Kaufmanns Bernhard Bose erhalten ist, in der er festhält, dass im August 1822 die „Sandstrasse“ ein neues Bachbett westlich um das damalige Dorf herum bekommen habe und das alte zugeschüttet werde. Er nennt den Bach „Sandstrasse“, weil er für dessen plattdeutschen Namen „Sandstraot“ (plattdeutsch Straot, mit offenem o wie in Wort= Strasse) keine andere Übersetzung kannte und weil der Bach ja auch wirklich von einer Strasse begleitet wurde. Hier muss gesagt werden, dass neben dem plattdeutschen Wort „Straot“ = Strasse noch ein zweites, sehr ähnliches plattdeutsches Wort existiert: „Struot“, das Gurgel, Kehle, Halsloch bedeutet (engl. throat = Schlund, Hals). Nur dem geübten Plattdeutschsprecher wird es gelingen, den kaum hörbaren Unterschied der Laute richtig wiederzugeben. Die Sandstrasse war ursprünglich eine Sandstruot, ein Sandschlund, ein Sandhals, eine Sandröhre, durch die unentwegt Wasser strömte, weil sie ein Bach war. Die Seitenwege fügten die Anwohner selbst hinzu. Vielleicht haben sie diese Wege schon immer Straot/Strasse genannt und eines Tages keinen Unterschied mehr zwischen Struot und Straot gemacht. Warum auch – sie waren schließlich keine Sprachwissenschaftler! Der Bachname „Sandstruot“ scheint damals gar nicht so selten gewesen zu sein. So gab es nach dem Urmesstischblatt zum Beispiel südlich von Lüdinghausen auch einen „Sandstrutenbach“, der mit dem Beverbach identisch war. An der Selmer Strasse, wo der Bach renaturiert ist, ist das Gelände sehr sandig. So ist es auch in der Ascheberger Sandstrasse, wenigstens in ihrem nördlichen Teil. Ihr Name lässt sich also mit „sandiger Durchlass, Sandhals, Sandröhre“ und natürlich „Sandbach“ übersetzen. „Sand“ ist aber auch ein indogermanisches Wasserwort, enthalten in Sandebeck, Senden, Sentrup, Sinderstedt, Sondern und Sundern und in dem Verb sintern, wo es auffällig auf Wasser hinweist. Der Sandbach in Ascheberg verschwand 1822 nicht nur aus dem Ortsbild, sondern auch aus der Erinnerung. Rund 60 Jahre später haben Julius Schwieters und Adolph Tibus anscheinend keine Ascheberger mehr gefunden, die ihnen aufgrund eigener Erinnerung oder von Erzählungen der Großeltern von dem Sandbach berichteten. Sonst hätten die beiden verdienstvollen Historiker ihn sicher erwähnt. Allerdings wissen wir nicht sicher, ob sie persönlich in Ascheberg geforscht haben. Der in den vielen Jahrhunderten der Ascheberger Ortskirchengeschichte das Dorfbild beherrschende Sandbach wurde und wird auch heute noch kaum einmal erwähnt, während der Emmerbach, der für die Entwicklung der Dorfbauerschaft von nur geringer Bedeutung war, allenfalls als Mitverursacher der häufigen Sandbachüberschwemmungen, immer wieder genannt wird. In vielen Gemeinden ist die Kirche in der Nähe eines Baches erbaut worden: in Senden am Dümmer, in Drensteinfurt an der Werse, in Amelsbüren am Emmerbach, in Lüdinghausen an der Stever. In Ascheberg stand sie am Sandbach. (siehe auch unter Straßen) |
Heimatverein Ascheberg | Im Heubrock 7 | 59387 Ascheberg
info@heimatverein-ascheberg.de
